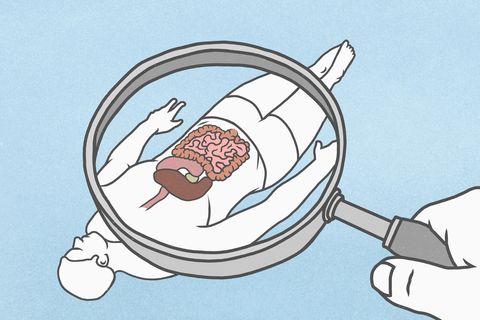Lange als esoterische Spinnerei verschrien, gilt Fasten in der Medizin zunehmend als Heilsbringer. Eine Chance für den Körper, gründlich aufzuräumen und dabei nicht nur hartnäckige Fettreserven anzubrechen, sondern auch angesammelten Zellmüll loszuwerden, Schäden zu reparieren und aus dem Gleichgewicht geratene Stoffwechselprozesse neu einzustellen. Bluthochdruck, Typ-II-Diabetes, Übergewicht, Reizdarm? Fasten hilft, erklärt die Forschung. Denn unser Körper ist evolutionär auf Phasen des Verzichts geeicht, nicht auf die Dauerverfügbarkeit nahrhafter Lebensmittel.
Doch gilt das auch für unser Gehirn? Obwohl es nur zwei Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, ist es ein Spitzenverbraucher. Es setzt täglich rund 500 Kilokalorien um. Von allen Organen hat es den höchsten Bedarf an Glukose, dem schnellen Energielieferanten unseres Körpers. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass ein leerer Magen uns geistig träge macht – insbesondere in der Übergangsphase, in der die Glykogenspeicher geleert sind und unser Körper auf Ketone als alternative Energiequelle umsteigt.
Womöglich zwackt ein hungriges Gehirn auch kognitive Ressourcen für die Nahrungsbeschaffung ab, die dann nicht mehr für andere Aufgaben zur Verfügung stehen. "Obwohl Fasten in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, gibt es weit verbreitete Bedenken, dass der Verzicht auf Nahrung die geistige Leistungsfähigkeit akut beeinträchtigen könnte", sagt David Moreau, Professor für Psychologie an der Universität Auckland in Neuseeland. Schon die Überzeugung, mit leerem Magen langsamer zu denken, könnte die erwarteten Einbußen auslösen, Stichwort Placeboeffekt.
Eine verpasste Mahlzeit hat kaum einen Effekt
Erkaufen sich Fastende die körperliche Regeneration also mit kognitiven Einbußen im Alltag? Dieser Frage gingen Moreau und sein Team in einer Übersichtsarbeit nach, die nun im "Psychological Bulletin" der American Psychological Society erschienen ist. Die Auswertung schloss 71 Studien mit insgesamt 3484 gesunden Teilnehmenden ein. Manche von ihnen hatten gegessen, bevor man ihre Gedächtnisleistung, ihre Entscheidungsfähigkeit, das Tempo und die Genauigkeit ihrer Reaktionen testete. Andere hatten zuvor eine Essenspause eingelegt. Die durchschnittliche Fastendauer lag bei zwölf Stunden, entsprach also meist dem Verzicht auf eine Mahlzeit.

Die einzelnen Studien lieferten gemischte Ergebnisse zum Effekt des Fastens. Die statistische Auswertung im Rahmen einer Metaanalyse legte jedoch nahe, dass die Hungrigen im Schnitt geistig so fit waren wie die Satten. "Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben blieb die kognitive Leistungsfähigkeit bemerkenswert stabil", sagt Moreau. "Viele Menschen glauben, dass das Auslassen einer Mahlzeit zu einem sofortigen Rückgang der geistigen Leistungsfähigkeit führt, aber unsere Auswertung sagt etwas anderes." Erst bei der detaillierten Betrachtung der Ergebnisse zeigten sich Unterschiede. So schnitten Menschen mit leerem Magen tendenziell etwas schlechter ab, wenn die Aufgaben einen Bezug zum Thema Essen hatten – vielleicht, weil Bilder von vollen Tellern oder Begriffe aus der Welt der Lebensmittel sie besonders stark ablenkten.
Die U-Kurve der geistigen Leistungsfähigkeit
Hatten die Gesättigten gegenüber Kurzzeit-Fastenden einen minimalen Leistungsvorsprung, verkehrte sich dieser schließlich ins Gegenteil: Wer den Großteil des Tages oder sogar mehrere Tage lang auf Nahrung verzichtet hatte, war den Vollgefutterten gegenüber geringfügig im Vorteil. "Sowohl unsere Ergebnisse als auch die bisherige Literatur stützen eine U-förmige Beziehung zwischen Fastendauer und kognitiver Leistungsfähigkeit", schreiben die Forschenden. "Kurzes Fasten hat nur minimale Auswirkungen, mäßige Fastenzeiten – wenn der Hunger seinen Höhepunkt erreicht und eine metabolische Umstellung stattfindet – können die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, und längeres Fasten scheint eine Erholung zu ermöglichen." Das Team erwägt für diesen Effekt zwei Erklärungsansätze: die erfolgreiche Umstellung des Gehirns von Glukose- auf Ketonstoffwechsel und eine Gewöhnung an die nagende Leere im Bauch.
Eine Ausnahme stellten Kinder dar. Ihre Leistung ließ mit zunehmender Fastendauer messbar nach. Darin deckt sich die Untersuchung mit weiteren Forschungsarbeiten, die beispielsweise die Bedeutung eines nahrhaften Frühstücks für Schulkinder hervorheben. Das wachsende Gehirn scheint also auf steten Glukosenachschub angewiesen zu sein – und junge Menschen besonders empfindlich gegenüber quälendem Magenknurren.
Welchen Einfluss Routine beim Fasten hat, konnten die Forschenden anhand der ausgewerteten Studien nicht herausfinden: Nur vier Arbeiten untersuchten Menschen, deren Essenspausen einem festen Ablauf folgten. Auch die übrigen Studien wiesen zum Teil schwere methodische Mängel auf. Mal wurde die Dauer der Fastenperiode nicht präzise angegeben, mal fehlten Informationen dazu, zu welcher Tageszeit kognitive Tests absolviert wurden. Dabei spielen Rhythmen des Tageslaufs eine wichtige Rolle bei Stoffwechselprozessen. In nur zehn Studien war der Blutzuckerspiegel der Teilnehmenden gemessen worden. Arbeiten, die sich mit den Effekten religiösen Fastens beschäftigten, hatte Moreaus Team von vornherein ausgeschlossen.
Was die Forschenden sich wünschen? Größere, methodisch saubere und vergleichbar aufgebaute Studien, die viele Parameter gleichzeitig erheben – etwa objektive Stoffwechselwerte und subjektive Wahrnehmung. Und einen genaueren Blick auf Details und Kontext, der über einen plumpen Vergleich von Menschen mit leerem und vollem Magen hinausgeht.
Auch wenn wir hungrig weiterhin auf Zack sind, kann ein leerer Magen übrigens trotzdem schlechte Laune machen. Zahlreiche Studien belegen, dass viele Menschen in der Tat "hangry" werden, wütend und hungrig zugleich. Die Aggressionen nehmen zu, die Selbstkontrolle bröckelt. Doch auch hier gilt: Wer den Nahrungsverzicht lang genug durchhält, wird womöglich mit einem Fastenhoch belohnt.