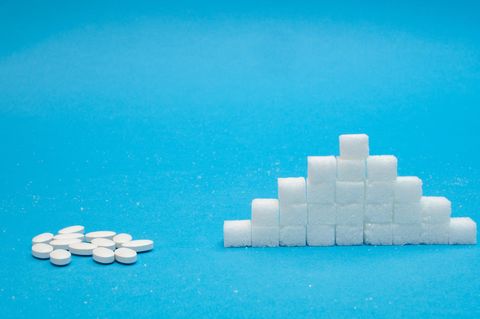Die Evolution hat dem Menschen eine rosa getönte Brille auf die Nase gesetzt. Eine, die uns optimistisch in die Zukunft blicken und das Künftige zuversichtlich, also in hellen und schönen Farben ausmalen lässt. Geschickt profitieren wir von dieser Denkverzerrung. Sie hilft uns offenbar, uns auch in schwierigen Zeiten als selbstwirksam und Lenker unserer Geschicke wahrzunehmen.
Diese eine Zigarette? Sie wird schon nicht schaden, krank werden ja nur die anderen. Das eine Glas? Spielend können wir noch selbst am Steuer des Autos heimfahren, haben alles souverän im Griff. Die Investition an der Börse? In diesem persönlichen Fall wird sie uns Reichtum bescheren. Traurig nur, dass der Nachbar mit Aktien so viel Pech hatte. Unsere Ehe? Trotz Scheidungsstatistik wird die Liebe wohl ewig halten. Auch das Risiko, an bestimmten Krankheiten wie Krebs oder einem Herzinfarkt zu erkranken, stufen viele Menschen für sich persönlich geringer ein als für den Durchschnitt der Bevölkerung.
Positive Prognose über die Zukunft
Menschen tendieren generell dazu, das Eintreten von positiven Ereignissen für sich selbst als wahrscheinlicher einzustufen, negative Ereignisse oder Risiken dagegen niedriger als bei ihren Mitmenschen zu bewerten. Diese Selbsttäuschung nennen Psychologen den "Optimismus-Bias", eine Denkverzerrung der Zukunftsprognose hin zum Positiven.
Basis der Wahrnehmungsverzerrung ist die Fähigkeit zu einem "Mental Time Travel", das Vermögen, im Medium der Einbildungskraft mental in die Zukunft vorauszueilen. Trotz besseren Wissens und vorhandener Informationen gehen Menschen bei diesen Fantasiereisen für sich selbst von einer positiven Entwicklung aus. Erklären lässt sich diese Tendenz einerseits durch asymmetrisches Lernen: Wir aktualisieren und verändern unsere Grundüberzeugungen stärker durch positive Informationen als durch negative. Neurobiologisch werden Letztere durch einen Trick des Gehirns einfach ausgeblendet und ignoriert. Die Tendenz findet sich bei gesunden Menschen generell. Allerdings können Armut oder eine feindselige Erziehung in der Kindheit den optimistischen Bias etwas trüben. Sie führen dann zu einer resignativeren Sicht auf die Zukunft.

Evolutionär half die Selbsttäuschung den Menschen wohl beim Überleben, denn ein zuversichtlicher Blick reduziert einleuchtenderweise auch belastende Stress- und Angstgefühle und hält handlungsfähig. Die optimistische Einstellung entfaltet sogar günstige Gesundheitseffekte, etwa mit Blick auf kardiovaskuläre Risiken: Das Herz profitiert, wenn wir weniger Zukunftsstress und Angst, dafür mehr gelassene Gefühle erleben.
Optimismus ist neurobiologisch in das Gehirn eingeschrieben
Da die optimistische Tönung so essenziell für das Überleben (und sogar bei Tieren nachweisbar) ist, wurde auch die Wissenschaft auf das Phänomen aufmerksam. Forschende stellten fest: Optimismus ist sogar neurobiologisch in das Gehirn eingeschrieben. Als wegweisend gelten dafür Studien der Neurowissenschaftlerin Tali Sharot, die funktionale Magnetresonanztomografie einsetzte, um zu zeigen, wie positive und negative Informationen in den Gehirnhälften verarbeitet werden. Demnach hinterlassen positive Informationen stärkere Reaktionen in der linken inferioren Stirnwindung. Das Gehirn filtert sozusagen negative Informationen (die in der schwächer reagierenden rechten inferioren Stirnwindung verarbeitet werden) etwas heraus.
Daneben legt die rosarote Täuschung auch das Fundament für Resilienz, also für eine hochwirksame seelische Abwehrstärke in krisenhaften Zeiten. Die Welt nicht exakt so zu sehen, wie sie ist, sondern in einem helleren Licht wahrzunehmen, kann durchaus vor depressiven Gefühlen schützen. Depressive verfügen nämlich den Beobachtungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zufolge nicht über einen Optimismus-Bias. Bei ihnen lässt sich eine pessimistische Verzerrung feststellen.
Schaut man auf die psychologische Feinmechanik hinter der Selbsttäuschung, so beruht die glückliche Verzerrung vor allem auch auf einer Kontrollillusion. Gerne nehmen wir Menschen an, Einfluss auf Risiken nehmen zu können, und erleben uns als Steuermann oder -frau, was oftmals nur bedingt der Fall ist.
Ein weiterer Mechanismus hinter der Täuschung ist verzerrtes Relativitätserleben. Es manifestiert sich darin, die eigenen Aussichten generell günstiger als die des Durchschnitts zu bewerten. Der private Optimismus über die Zukunft unserer Kinder und Familie funktioniert daher trotz anderweitiger Faktenlage, weil Zahlen über Risiken zwar bekannt sind, jedoch nicht als zutreffend für das eigene Leben wahrgenommen werden.
Kontrollillusion und Mutlosigkeit
Ein nachvollziehbarer Effekt des Optimismus-Bias besteht darin, Mutlosigkeit und Lähmung abzuwehren und Menschen mental gesund zu halten. Experten gehen davon aus, dass wir ohne diese Verzerrung wohl alle eine milde Form von Depressivität und Niedergeschlagenheit erleben würden. Wir schätzen allerdings nicht nur persönliche Risiken zu günstig ein, sondern bewerten auch unsere Kompetenzen in einem zu euphorischen Licht. Bei psychologischen Befragungen schätzen sich Teilnehmende als sozial verträglicher, interessanter und fähiger ein als der Durchschnitt. Doch ist dieser wärmende rosa Mantel, in den wir uns alle evolutionär bedingt hüllen, generell gut für uns?
Zumindest hilft der optimistische Zukunftsblick, um von einer gewissen Vorfreude zu profitieren und in der Gegenwart Wohlgefühle zu genießen. Denn die erleben Menschen bereits in ihrer Fantasie, also wenn sie sich die Zukunft nur in schönen Farben ausmalen. Paradoxerweise kann dies allerdings dazu verleiten, sich weniger für das reale positive Resultat anzustrengen.
Wie also gelingt es, sich von unrealistischem Optimismus und seinen Schattenseiten zu schützen, zugleich aber hoffnungsvoll zu bleiben? Die Lösung besteht darin, die optimistische Einstellung zu bewahren, trotzdem aber den schlechtesten Ausgang zu bedenken und Vorkehrungen zu treffen.
Denn einem "konstruktiv vorbereiteten Optimisten" steht die Zukunft offen. Er oder sie hat schließlich seinen (realen oder mentalen) Airbag als Helfer, einen Plan B, wenn es wider Erwarten zum harten Aufprall in der Realität kommt oder die rosa Brille zu verrutschen droht.