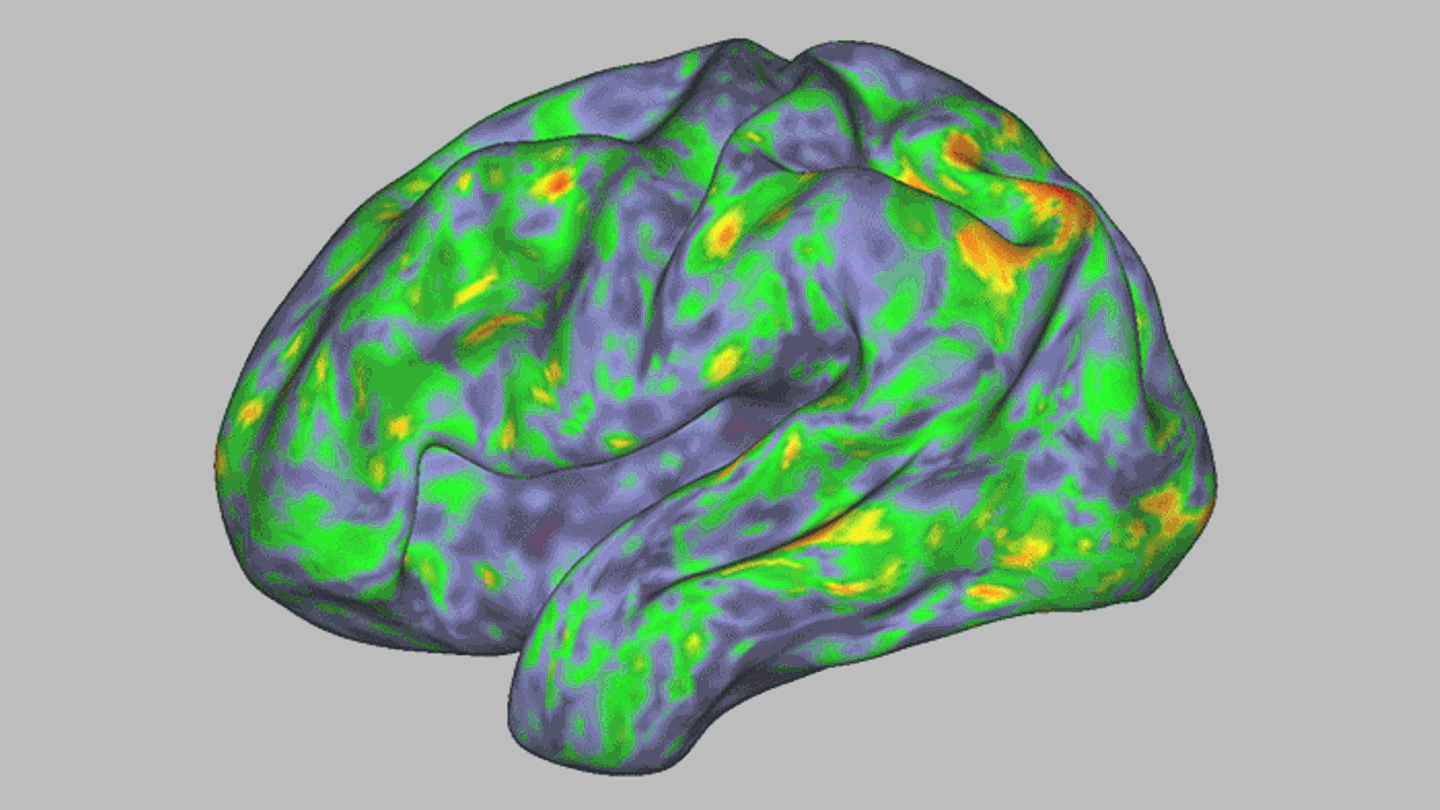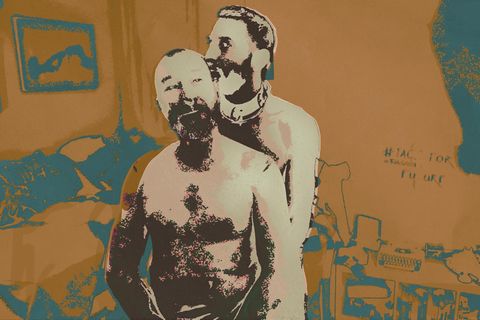Ein Kaleidoskop an Farben, das über weite Teile eines menschlichen Gehirns wirbelt: So sieht eine animierte Grafik aus, die Forschende der University of Medicine in St. Louis jüngst veröffentlicht haben. Sie ist aus mehreren Scans zusammengesetzt, die mithilfe funktionaler Magnetresonanztomographie (fMRT) entstanden sind – einer Methode, die Veränderungen der neuronalen Aktivität sichtbar macht.
Im Rahmen einer Studie erhielten sieben Probanden entweder eine Einzeldosis Psilocybin, auch als Wirkstoff in "Magic Mushroom" bekannt, oder ein Placebo in Form eines Amphetamins. Psilocybin gehört zur Gruppe der Psychedelika, also jener Stoffe, die für einige Zeit das Bewusstsein und die Wahrnehmung verändern. Oft ruft die Substanz visuelle Halluzinationen hervor sowie das Gefühl, sich aufzulösen und mit der Umwelt zu verschmelzen.
Lindern Drogen Depressionen?
In jüngerer Vergangenheit ist zudem die therapeutische Wirkung derartiger Drogen in den Fokus gerückt: In bestimmten Fällen scheinen sie zu einer dauerhaften Linderung von Depressionen, Angstzuständen und anderen psychischen Störungen beitragen zu können.
Die Teilnehmenden der aktuellen Untersuchung waren gesund und unterzogen sich insgesamt 18 Gehirnscans, die vor, während und nach der ersten Einnahme durchgeführt wurden. Die Blau- und Grüntöne in den Aufnahmen spiegeln die normale Hirnaktivität wider, die typisch für neuronale Netze ist, die verschiedene Regionen des Gehirns miteinander verbinden. Die gelben, orangefarbenen und roten Töne markieren deutliche Abweichungen von ebendiesen Aktivitätsmustern.
Sie offenbaren einen regelrechten neuronalen Sturm, den die psychedelische Substanz zeitweilig entfacht. Von der massiven Wirkung zeigen sich selbst die Wissenschaftler überrascht: Sie scheint unter dem Einfluss von Psylocibin dreimal stärker zu sein als nach der Einnahme des als Placebo verwendeten Metamphetamins – ebenfalls eine psychoaktive Substanz.
Langfristig destruktive Denkmuster durchbrechen
Laut den Autorinnen und Autoren der Studie treten die Störungen vor allem in jenen Teilen des Gehirns auf, die mit introspektivem Denken, wie Tagträumen und Erinnerungen, verknüpft sind. Diese Bereiche helfen unter anderem dabei, ein kohärentes Selbstverständnis zu erlangen. Das temporäre Durcheinander befeuert höchstwahrscheinlich die Neuroplastizität des Gehirns, seine Fähigkeit also, neue Perspektiven zu entwickeln. So könnte sich erklären, wie psychedelische Substanzen manchen Patienten helfen, langfristig destruktive Denkmuster zu durchbrechen.
Die Hoffnung des Teams aus St. Louis: Wird mehr über die neurobiologischen Mechanismen bekannt, die Substanzen wie Psylocibin in Gang setzten, könnte dies der medizinischen Anerkennung von Drogen weiter Auftrieb verleihen.