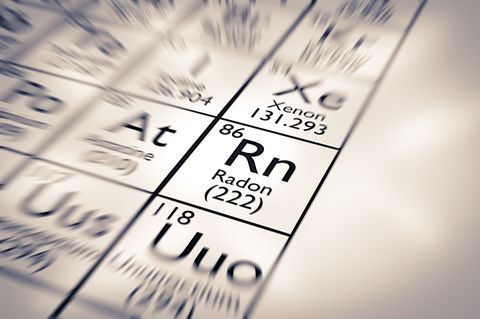Es erscheint paradox: Der Klimawandel schreitet ungebremst voran, die Gefahr von Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürreperioden nimmt zu, die Luftverschmutzung in Städten bleibt hoch – aber zugleich machen die Menschen sich weniger Sorgen, dass Umweltprobleme ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK.
So gaben zwar 84 Prozent der mehr als 3000 Befragten an, der Umweltschutz sei "wichtig" oder "sehr wichtig". Doch während bei der Vorgängerbefragung vor vier Jahren noch 79 Prozent angegeben hatten, der Klimawandel bereite ihnen Sorgen, waren es 2024 nur noch 66 Prozent. Auch das Thema Luftverschmutzung sehen mehr Menschen gelassener: Der Prozentsatz der Menschen, die sich Sorgen machen, sank von 56 auf 45 im Jahr 2024. Die Frage, ob Umweltverschmutzung und Schadstoffe ihre eigene Gesundheit beeinträchtigen, beantworteten nur noch rund ein Viertel mit ja. Vor vier Jahren waren es immerhin noch 40 Prozent.
Andererseits glauben immer mehr Menschen, dass Umweltprobleme "stark übertrieben" würden: laut der aktuellen Befragung fast ein Drittel (29 Prozent). Das sind zehn Prozent mehr als noch vor vier Jahren. "Die Ergebnisse bestätigten den Trend einer aktuell rückläufigen Bedeutung von Umweltthemen", sagt Sophie Rabe, Erstautorin des Berichts, in einer Presseerklärung.
Trend bestätigt sich: Umweltthemen erhalten weniger Aufmerksamkeit
Erst kürzlich hatte die alle zwei Jahre stattfindende Umfrage des Umweltbundesamtes zum Umweltbewusstsein in Deutschland gezeigt, dass die Zahl der Menschen, die Klima- und Umweltschutz für "sehr wichtig" halten, seit Jahren rückläufig ist. Auch unterstützen immer weniger Menschen – im Jahr 2025 waren es 57 Prozent, fünf Prozent weniger als 2022 – das Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.
Als Gründe für diesen Trend sieht Rabe eine "Überlagerung des Umweltthemas" durch andere Krisen und gesellschaftliche Herausforderungen. Zudem berichteten Medien weniger über Umweltthemen. Mitautor Jürgen Klauber macht noch einen weiteren Punkt geltend: "Auch die zunehmende ideologische Aufladung gerade des Themas Klimawandel dürfte zu den Verschiebungen in der Wahrnehmung der Bevölkerung beitragen."
Die Befragten sehen nicht nur ihre eigene Situation gelassener – sondern auch die zukünftiger Generationen. Vor vier Jahren antworteten noch rund drei Viertel auf die Frage, wie sehr Umweltverschmutzung und Schadstoffe die Gesundheit unserer Kinder und Enkelkinder belasten werden, mit "stark" oder "sehr stark". Ausweislich der aktuellen Studie sind es nur noch rund zwei Drittel.