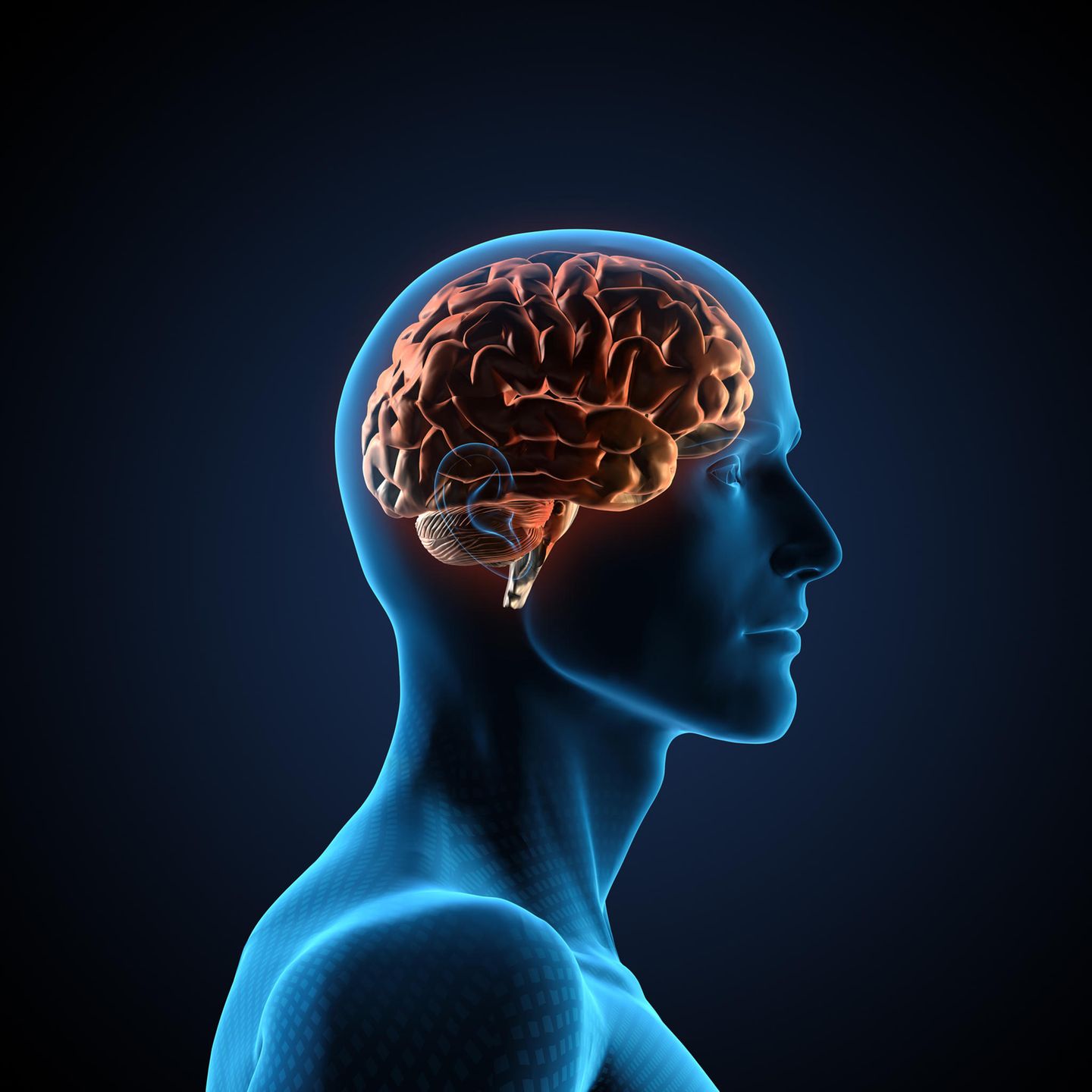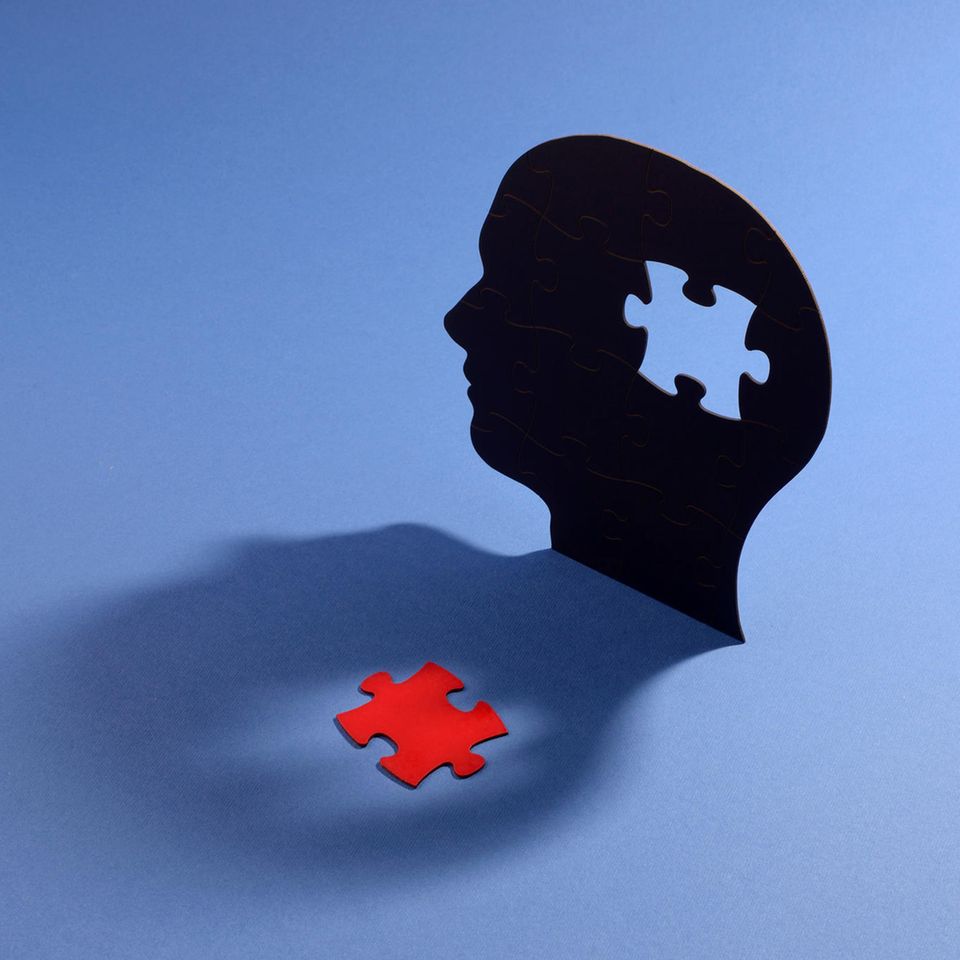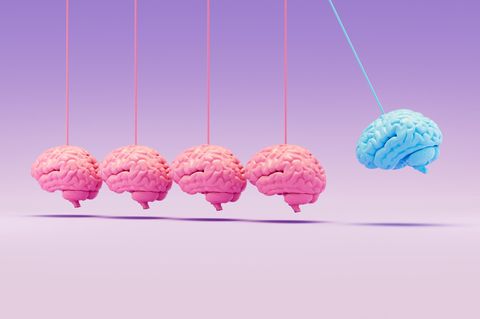Der evolutionäre Erfolg des Menschen hängt in erster Linie an seinem Gehirn. Es entwickelte sich zu einem immer komplexeren – und im Vergleich zu seinen frühen Ahnen größeren – Denkapparat, der unter anderem dazu befähigte, Werkzeuge zu konstruieren und die Umwelt nach einem Plan zu gestalten.
Zwar ist Verstandeskraft nicht allein eine Frage des Hirnvolumens. Vielmehr kommt es etwa darauf an, wie rasch Signale zwischen einzelnen Nervenzellen ausgetauscht werden, wie effizient verschiedene Bereiche miteinander vernetzt sind. Doch klar ist: Erst ein beträchtliches Gehirn ermöglichte den Siegeszug der Gattung Homo.
Und die evolutionäre Obergrenze für das Gehirnvolumen scheint noch nicht erreicht zu sein: Im vergangenen Jahrhundert sind die menschlichen Denkorgane immer größer geworden. Das zeigt eine Auswertung von MRT-Aufnahmen aus der US-Kleinstadt Framingham, deren Bewohner sich seit der Nachkriegszeit an der weltweit umfangreichsten Kohortenstudie zu Herz-Kreislauf- und anderen Erkrankungen beteiligen. Die ursprüngliche Kohorte bestand aus 5209 Männern und Frauen im Alter zwischen 30 und 62 Jahren. Die Forschung wird seit 75 Jahren fortgesetzt und umfasst inzwischen die zweite und dritte Generation von Teilnehmenden.
Hirnoberfläche wächst in vier Jahrzehnten um 15 Prozent
Die nun analysierten Hirnscans, die seit 1999 systematisch angefertigt werden, stammen von mehr als 3000 Personen und umfassen Geburtenjahrgänge aus über fünf Jahrzehnten. Sie zeigen eine allmähliche, aber konstante Zunahme verschiedener Gehirnstrukturen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. So betrug das durchschnittliche Hirnvolumen bei Probanden, die in den 1930er-Jahren geboren wurden, 1234 Milliliter. Bei den in den 1970er-Jahren Geborenen vergrößerte es sich auf 1321 Milliliter, ein Anstieg um 6,6 Prozent.
Die äußerste Schicht des Großhirns, die kortikale Oberfläche, nahm im Laufe der Jahrzehnte sogar noch stärker zu. Wer in den 1970er-Jahren auf die Welt kam, hatte eine durchschnittliche Oberfläche von 2104 Quadratzentimetern. Bei den 1930er-Jahrgängen waren es im Vergleich nur 2056 Quadratzentimetern – fast 15 Prozent weniger.
Auch fand das Forschungsteam um den Neurobiologen Charles DeCarli von der University of California in Davis heraus, dass Gehirnstrukturen wie die weiße Substanz, die graue Substanz und insbesondere der Hippocampus (eine Hirnregion, die an Lernen und Gedächtnis beteiligt ist) ebenfalls signifikant an Größe zunahmen.
Genetik und Umwelt bestimmen Gehirngröße
Parallel dazu wuchsen auch die Körper der Menschen: von durchschnittlich 168 Zentimetern in den 1930er- auf 172 Zentimeter in den 1970er-Jahren – ein Anstieg um 2,4 Prozent. Doch selbst wenn man diesen Faktor berücksichtigt, vergrößerte sich das Gehirn der Bürgerinnen und Bürger von Framingham im Laufe dieser Zeit um 5,9 Prozent.
Die Gründe für den Zuwachs sind laut der Expertinnen und Experten vielfältig: "Die Genetik hat maßgeblichen Einfluss auf die Gehirngröße, aber unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch äußere Umstände wie gesundheitliche, soziale, kulturelle und erzieherische Faktoren eine Rolle spielen", erklärt Studienautor DeCarli. Die beobachteten Veränderungen könnten auf eine durch diese Faktoren insgesamt verbesserte Gehirnentwicklung und -gesundheit zurückzuführen sein.
Mehr Volumen bedeutet mehr Reserve
Mit potenziell vorteilhaften Folgen für viele von uns. Denn größere Gehirne bieten möglicherweise einen größeren Schutz vor Demenz. Obwohl die Fallzahlen mit der alternden Bevölkerung Amerikas steigen, geht die Inzidenz der Alzheimer-Krankheit – der Anteil der von der Krankheit betroffenen Bevölkerung – zurück. Seit den 1970er-Jahren um 20 Prozent pro Jahrzehnt, wie eine frühere Studie offenbarte. Eine Ursache dafür könnte die verbesserte Gesundheit und Größe des Gehirns sein. "Eine größere Gehirnstruktur steht für eine größere Gehirnreserve und kann die Spätfolgen von altersbedingten Gehirnerkrankungen wie Alzheimer und verwandten Demenzerkrankungen ein Stückweit abfedern", so DeCarli.
Für die oder den Einzelnen mag der Effekt geringfügig sein – gemessen an der Gesamtbevölkerung ist er gleichwohl bemerkenswert. Einschränkend geben die Wissenschaftler zu bedenken, dass die untersuchten Personen überwiegend weiß, gesund, gut ausgebildet und daher nicht repräsentativ für die breitere US-Bevölkerung sind.