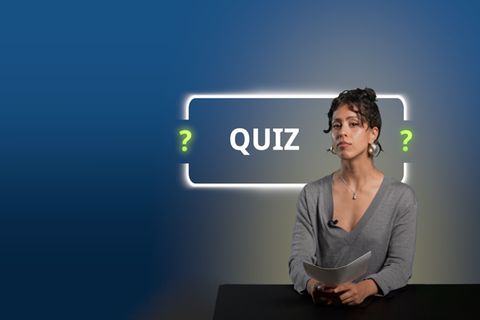Eine Prise kindlicher Begeisterung, eine Spur Verrücktheit und Verspieltheit: All diese Eigenschaften können Menschen anziehend machen. Mit ihnen ist das Zusammensein vergnüglich, sie schillern wie Seifenblasen im Sonnenlicht. Alles schwebt, alles ist leicht. Mit ihnen wird es nicht langweilig, für sie bietet das Leben an jeder Ecke Abenteuer und Genuss. Doch es gibt ein Zuviel des Faszinierenden.
Die Psychologie kennt den Begriff der "grenzwertigen Kindlichkeit". Diese zeigt sich als Entwicklungshemmung: Psychologen berichten von Menschen, die sich regelrecht weigern, erwachsen zu werden. Da lungert ein 42-Jähriger den Tag über auf der Couch und verzockt sein Leben vor Computer- oder Glücksspielen.
Sein Tagesplan? Er macht, wozu er Lust hat, folgt Tagträumen oder skurrilen Hobbies, so beschreibt es der renommierte Psychologe und Angstforscher Professor Borwin Bandelow. Oftmals wird dieses "infantile Drama" mit einer co-abhängigen Partnerin inszeniert. Sie sorgt dafür, dass sein Laden nicht gänzlich im Chaos versinkt. Einer geregelten Arbeit geht ihr Partner nicht nach, ihm reicht das Belohnungssystem in seinem Gehirn. Wie ein Kind folgt er Impulsen, die Spaß versprechen und Dopamin ausschütten: Spiele, Drogen und fantastische Tagträumereien, auch genussvolles Essen oder Sex sind dabei.
Seit den 1980er-Jahren wird dieses Verhalten als "Peter-Pan-Syndrom" beschrieben. Der Familientherapeut Dr. Dan Kiley prägte in seinem Buch Men who have never grown up den Begriff. Er suchte eine Metapher für männliche Unreife und ein Verhalten, das dem Korsett gesellschaftlicher Vernunft zu entkommen trachtet.
Der Familientherapeut beschrieb in späteren Auflagen seines Werks sieben Kernmerkmale der Störung: Emotionale Abgestumpftheit sowie Trägheit (Slowness) zählen dazu. Desweiteren Prokrastination, also das Aufschieben wichtiger Anliegen. Dazu kommt Verantwortungslosigkeit und schließlich eine pathologische Fixierung auf jugendliche Freiheit und Unverbindlichkeit. Dan Kiley gründete das Syndrom allerdings nicht auf systematische Studien, sondern kam zu seiner Theorie durch Beobachtung Jugendlicher in Kliniken. Von der Rezeption wurde seine Analyse als diskriminierend kritisiert, weil Kiley sich auf das männliche Geschlecht festlegte.
Heute wird das Syndrom auch als "Failure to Launch", als Fehlstart ins Erwachsenenleben mit seinen Rollen begriffen. Statt diese zu erfüllen und in ein gereiftes, vernünftiges Selbst zu wachsen, verharren entsprechende Persönlichkeiten in unreifem Verhalten: Sie prokrastinieren Aufgaben wie das Schreiben von Bewerbungen oder Business-Plänen, folgen ihrem Spieltrieb und sehen geringe Notwendigkeit, Geld zu verdienen oder pünktlich zu Terminen zu erscheinen, auch denen beim Arbeitsamt. Kurz: Sie vermeiden es, Verantwortung zu übernehmen. Das Syndrom führt zu Einsamkeit und fehlendem Lebensglück.
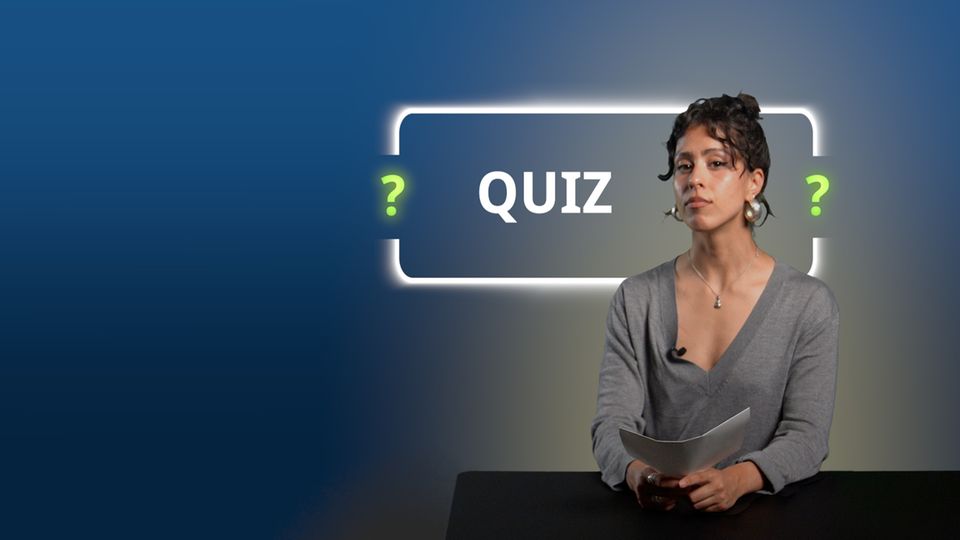
Kreativ und revolutionär
Bereits im frühen 20. Jahrhundert, in der analytischen Psychologie des berühmten Analytikers C.G. Jung, gibt es korrespondierende Beobachtungen. Jung beschrieb etwa Erwachsene, die in archetypischen Jugendlichkeitsmustern verharren. Sein Konzept des Puer aeternus (lat. für "ewiger Junge") zeigt Menschen, die sich vor Bindungen fürchten, einen Hang zum Tagträumen kultivieren und institutionelle Strukturen und Regeln ablehnen. Im Gegensatz zu Kileys populärer Darstellung betont Jungs Theorie die Ambivalenz des Phänomens: Der Puer verkörpert für C. G. Jung nicht nur kritikwürdige Unreife, sondern auch kreatives Potenzial und revolutionären Widerstand gegen konformistische Erwachsenenrollen. Dazu legte sich Jung nicht stigmatisierend auf ein Geschlecht fest.
Namensgeber für den gesamten Komplex ist der schottische Dramatiker James Matthew Barrie, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die literarische Figur des "Peter Pan" ersann. Barries Fantasie entsprang der Held, der beschließt, niemals erwachsen zu werden. Als Anführer der Bande der "Verlorenen Jungs" lebt er auf der Insel Neverland, ein Ort des ewigen Spiels. Die Geschichte handelt von der Freundschaft dreier Londoner Kinder mit diesem faszinierenden Peter Pan. Er lockt sie in sein traumhaftes "Nimmerland", wo sie unvorstellbare Abenteuer erleben. Schließlich aber treibt das Heimweh die Kinder zurück. Peter Pan bleibt am Ende einsam zurück. Seine Insel Nimmerland wurde in der Psychologie zur Metapher für ewiges Kind- und Jugenddasein sowie für Eskapismus, die Flucht aus dem Alltag.
Rückkehr aus dem Niemandsland?
Obwohl das Peter-Pan-Syndrom als populärpsychologisches Konzept keine anerkannte Diagnose darstellt, gilt es in der Psychoanalyse bis heute als Allegorie für Infantilismus und einen Schwebezustand in einer unwirklichen Leichtigkeit. Es zeigt Überschneidungen zu anerkannten psychischen Störungen, allen voran der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Gemeinsam sind beiden Typen Muster von Egoismus. Menschen mit einer Narzissmus-Diagnose neigen jedoch zu einem höheren Grad an Selbstüberschätzung und Anspruchsdenken als die ewig kindlichen Peter-Pan-Persönlichkeiten.
So bunt und unterhaltsam dieser Menschenschlag sein kann: Konflikte ergeben sich – wenig überraschend – im Berufsleben, aber auch in Liebesbindungen und Freundschaften, bei denen jeweils Verbindlichkeiten nicht eingehalten werden. Im Job führt die Störung zu häufigen Stellenwechseln. Klar, dieser Typus langweilt sich schnell und verliert das Interesse an Projekten und Aufgaben, zeigt geringes Durchhaltevermögen. Als Dynamit erweist sich auch die Aversion gegen betriebliche Regeln und Hierarchien.
Insgesamt wird der Beruf von ewig Jungen als Einschnitt in die persönliche Freiheit und im Grunde als Zumutung empfunden, der man sich nur bei großer Lust und Motivation stellt: Als Folge kommt es zu oft trotzigen Ausbrüchen und Unzuverlässigkeit: Termine zerplatzen, Zeitpläne werden konstant umgestellt, Aufgaben unvollständig erledigt. Auch die Abgabe einer Steuererklärung ist für Peter-Pan-Menschen nur eine "Kann"-Aufgabe.
Generell neigt der Typus dazu, auch konstruktive Kritik als Angriff zu begreifen, die Schuld viel eher bei Mitmenschen als bei sich zu sehen oder gleich beleidigt zu schweigen. Betroffene, die je auf einen Handwerker diesen Typs gesetzt haben, können ein Klagelied anstimmen: Baumaterialien warten dann wochenlang auf der Baustelle, der Meister selbst erscheint aber nicht. Im Feld romantischer Beziehungen verknüpft sich das kindliche Verhalten vor allem mit Bindungsangst und Unverbindlichkeit. Die Partnerin gerät eher in die Mutterrolle für einen ewigen Sohn als in eine Partnerschaft, bei der sich beide Seiten aneinander entwickeln. Auch diese weibliche Figur verewigte Familientherapeut Kiley in einem Buch mit dem übersetzten Titel Das Wendy-Dilemma. Das Dilemma der Frauen besteht darin, nicht sie selbst zu sein, weil sie "als Mutter" die Bedürfnisse eines anderen über die eigenen stellen - und oftmals daraus sogar einen narzisstischen Gewinn erzielen. Auch in der literarischen Vorlage des Romans Peter Pan fungiert Wendy als Mutterfigur für Peter und gewissermaßen als Brücke zur Realität.
Gibt es für das oft unterhaltsame Chaos im Leben eines Peter-Pan-Typen Heilung? Einen Ausweg aus dem "Niemandsland", wie Psychologen die kindliche Realitätsflucht in Anspielung auf die Insel "Neverland" des literarischen Helden nennen? Der Hebel liegt in der Einsicht des alternden Peter-Pan, den das Leben auch zurechtgeschliffen hat.
Denn natürlich sehen diese Menschen auch oft die Rote Karte, oft in Form von Kündigungen und Trennungen. Nicht an jedem prallt das spurlos ab. Ob schließlich das Gespräch über dominante oder traumatische Mutter- oder Vater-Figuren der Kindheit erfolgreich ist, bleibt eine spannende Reise. Übrigens gilt der Weltstar Michael Jackson als Prototyp dieses Menschen-Schlags. Auf seiner Ranch erschuf er sich eine von der Realität und erwachsenen Regeln abgeschirmte Fantasiewelt. Sein Domizil trägt den Namen Neverland.