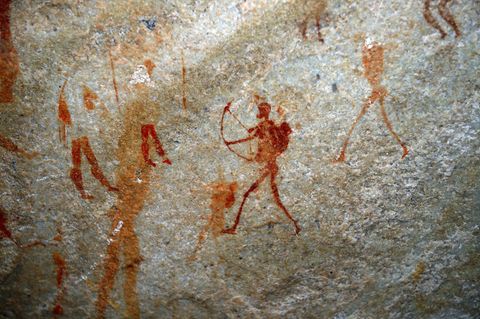Wochenende. Endlich Zeit zum Ausschlafen, Serien schauen, Freunde treffen. Und doch: Am Sonntagabend fühlt man sich seltsam leer – kaum erholt, schon wieder müde. So geht es vielen. Trotz Urlaub, Freizeit oder Wellness-Retreat stellt sich kein nachhaltiger Erholungseffekt ein. Der Kopf bleibt voll, die Gedanken kreisen um offene Aufgaben, der Körper bleibt angespannt.
Psychologinnen und Psychologen wissen inzwischen, warum das so ist: Erholung ist kein Automatismus, sondern ein aktiver psychologischer Prozess. Wer in seiner Freizeit bloß passiv konsumiert – durch Social Media scrollt oder sich vom Bildschirm berieseln lässt – entspannt zwar kurzfristig, regeneriert aber kaum.
Ein internationales Forscherteam um Jessica de Bloom und Sabine Sonnentag hat deshalb untersucht, was Menschen tatsächlich hilft, sich nachhaltig zu erholen. Ihr Ergebnis: Es sind sechs zentrale psychologische Bedürfnisse, die in Pausen erfüllt werden sollten, zusammengefasst im DRAMMA-Modell.
Was hinter dem DRAMMA-Modell steckt
Das Modell steht für sechs Dimensionen, die zusammen optimale Regeneration fördern: Detachment, Relaxation, Autonomy, Meaning, Mastery und Affiliation. Es beschreibt, was Pausen wohltuend macht – egal, ob nach Feierabend, im Urlaub oder zwischen zwei Terminen.
1. Detachment – Abschalten
Erholung beginnt im Kopf. Wer ständig über Arbeit oder Verpflichtungen nachdenkt, bleibt innerlich gebunden, selbst im Liegestuhl. „Psychologische Distanz“ nennen Forschende das. Abschalten gelingt besser, wenn man bewusst andere Reize zulässt: in der Natur, beim Sport oder durch Musik. Schon kleine mentale Brüche – etwa der Spaziergang nach Feierabend – helfen, Stresshormone abzubauen und den Arbeitstag wirklich loszulassen.
2. Relaxation – Entspannung
Erst wer loslässt, kann entspannen. Dabei geht es weniger um stundenlange Ruhe als um Phasen des vegetativen Umschaltens: Momente, in denen der Parasympathikus – der „Erholungsnerv“ des Körpers – aktiv wird. Das kann eine Tasse Tee am Fenster sein, eine Atemübung oder eine halbe Stunde Lesen. Entscheidend ist: Die Aktivität darf keinen Druck erzeugen. Auch die schönste Meditation verliert ihren Effekt, wenn sie zur Pflichtübung wird.
3. Autonomy – Selbstbestimmung
Erholung funktioniert nicht auf Kommando. Studien zeigen: Freizeit wirkt nur dann regenerativ, wenn sie selbstbestimmt erlebt wird. Wer seine Zeit fremdbestimmt verbringt – sei es durch Erwartungen anderer oder durch den eigenen Freizeitperfektionismus – empfindet oft mehr Stress als im Büro. Ob allein auf dem Sofa oder beim Kochen mit Freunden: Wichtig ist, dass man selbst wählen darf, was guttut.
4. Meaning – Sinnerleben
Überraschend, aber klar belegt: Erholung braucht nicht immer Faulheit, manchmal auch Tiefe. Menschen, die ihre Freizeit als bedeutsam erleben – etwa durch Ehrenamt, Kunst, Spiritualität oder Naturerfahrung –, berichten von höherer Zufriedenheit und geringerem Erschöpfungsgefühl. Das Sinngefühl stellt eine innere Balance her: Es verleiht selbst stillen Momenten Gewicht. Nicht der äußere Reiz zählt, sondern die Resonanz.
5. Mastery – Kompetenz erleben
Manchmal tut Anstrengung gut. Etwas Neues zu lernen, sich einer Herausforderung zu stellen oder eine Fähigkeit zu vertiefen, kann erstaunlich erholsam wirken, sofern es aus eigenem Antrieb geschieht. Forschende sprechen hier von Mastery-Erlebnissen. Sie steigern Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Energie. Ein Beispiel: Wer im Urlaub das Surfen lernt oder ein Instrument ausprobiert, kehrt oft erfrischter zurück als nach einer Woche passiven Dösens.
6. Affiliation – soziale Verbundenheit
Nichts regeneriert so stark wie gute Beziehungen. Gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche, geteilte Erlebnisse: Sie aktivieren im Gehirn das Belohnungssystem und senken Stresswerte messbar. Wichtig ist dabei die Qualität, nicht die Menge: Erholung braucht emotionale Nähe, keine Pflichtkontakte. Wer sich gesehen und verstanden fühlt, tankt auf. Wer sich in Gesellschaft verstellen muss, erschöpft.
Wenn alle sechs Dimensionen zusammenkommen
Je mehr dieser Bedürfnisse in der Freizeit erfüllt werden, desto nachhaltiger wirkt die Pause. Untersuchungen zeigen, dass DRAMMA-Erlebnisse nicht nur psychisch, sondern auch physiologisch messbare Effekte haben: Sie stabilisieren Herzfrequenzvariabilität, senken Cortisol und fördern den Schlaf.
Eine ausgewogene Freizeitgestaltung enthält daher meist mehrere Komponenten zugleich – etwa ein gemeinsames Abendessen mit Freund:innen (Affiliation), bei dem man entspannt (Relaxation), über anderes spricht als die Arbeit (Detachment) und vielleicht neue Ideen spinnt (Meaning, Mastery).
Kleine Pausen, große Wirkung
Das Prinzip gilt nicht nur für Wochenenden oder Urlaube. Schon kurze Unterbrechungen können DRAMMA-Erlebnisse auslösen – wenn sie bewusst gestaltet sind. Ein Spaziergang um den Block bringt Bewegung, frische Luft und soziale Begegnung; ein kurzer Moment der Stille zwischen zwei Meetings schafft mentale Distanz; ein freundliches Gespräch mit Kolleg:innen stärkt Zugehörigkeit. Sinnvoll sind solche „Mikropausen“ vor allem dann, wenn sie abwechslungsreich sind: mal aktiv, mal ruhig, mal allein, mal gemeinsam.
Erholung ist kein Luxus – sie ist ein Talent
Die Forschung zeigt: Menschen, die sich gut erholen können, sind nicht nur zufriedener, sondern auch produktiver, kreativer und gesünder. Doch das verlangt Achtsamkeit.
Denn echte Erholung bedeutet nicht, dem Alltag zu entfliehen, sondern ihn bewusst zu unterbrechen, um zu spüren, was einem guttut.
Vielleicht liegt darin die eigentliche Kunst des Ausruhens: zu erkennen, dass Erholung mehr ist als Nichtstun – sie ist ein feines Gleichgewicht aus Distanz und Nähe, aus Aktivität und Ruhe, aus Sinn und Sein.