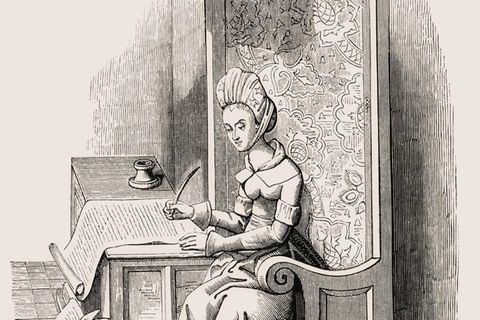Wer an Endometriose erkrankt ist, weiß das oftmals nicht. Gewebe ähnlich der Gebärmutterschleimhaut siedelt sich innerhalb der Gebärmuttermuskulatur und außerhalb der Gebärmutter an, beispielsweise an den Eileitern, an den Eierstöcken, am Bauchfell oder Darm. Betroffene leiden unter extremen Regelschmerzen und -blutungen, der Toilettengang bereitet Probleme, vaginaler Sex ist für viele undenkbar.
Trotzdem vergehen vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnose durchschnittlich mehr als zehn Jahre. Viele Ärzte nähmen die Leiden nicht ernst, berichten Betroffene, suchten die Ursachen in der Psyche der Frauen oder wiegelten sie als "normale" Regelbeschwerden ab. Um Endometriose auf die Schliche zu kommen, braucht es neben einer guten Anamnese eine Ultraschalluntersuchung und einen MRT-Scan. Eine stichfeste Diagnose erfordert bislang gar eine Bauchspiegelung mit Gewebeentnahme: einen operativen Eingriff.
Eine nun im Fachmagazin "Med" erschienene Studie könnte diese Hürden womöglich senken. Forschende der University of Houston stellen darin einen Zusammenhang zwischen dem menschlichen Darmmikrobiom und einer Endometriose-Erkrankung her. Dafür untersuchten sie die Stuhlproben von 18 erkrankten Frauen auf die Zusammensetzung der darin enthaltenen Stoffwechselprodukte und verglichen sie mit jenen von 31 nicht erkrankten.
Das Ergebnis: Der Stuhl der erkrankten Frauen wies ein Muster auf, das laut den Forschenden typisch für eine Endometriose-Erkrankung zu sein scheint. Ein Zusammenhang mit spezifischen Bakterien im Darm bei Endometriose sei der Fachwelt zwar bereits bekannt, kommentierte Peter Oppelt, Vorstand der Universitätsklinik für Gynäkologie gegenüber dem "Science Media Dienst" (SMC). Der Zusammenhang von normalen Darmbakterien und Endometriose hingegen sei neu.
Jährlich könnte es in Deutschland 40.000 neue Neuerkrankungen geben
Aufhorchen lässt jedoch vor allem die neue Diagnosemöglichkeit, die die Studie aus Houston verspricht: Erweisen sich ihre Ergebnisse in weiteren Studien als valide, könnte bald schon eine einfache Stuhlprobe reichen, um eine Endometriose-Erkrankung nachzuweisen. "Der Test scheint sehr spezifisch zu sein", sagte Oppelt. "Der Bedarf für einen nicht-invasiven Diagnostiktest ist sehr hoch. Die Diagnostik ist oft noch ein Stiefkind bei Endometriose."
Ungefähr acht bis 15 Prozent der Menschen mit Uterus im geschlechtsreifen Alter sind von ihr betroffen, mit verschieden schweren Ausprägungen des Leidens. In Deutschland wurde im Jahr 2022 bei 9,5 Prozent der Menschen mit Gebärmutter eine Endometriose diagnostiziert. Fachleute gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Allein in Deutschland, schätzt die Endometriose Vereinigung Deutschland, könnte es jährlich 40.000 Neuerkrankungen geben.
Dass Endometriose oft unerkannt bleibt, hat mitunter fatale Folgen: "Je später die Frauen diagnostiziert werden, desto stärker werden die Beschwerden und desto schlechter stehen die Chancen, schwanger zu werden", sagt die leitende Gynäkologin Sylvia Mechsner vom Endometriosezentrum der Berliner Charité im GEO-Interview. "In der Gruppe der unfruchtbaren Frauen haben 40 bis 50 Prozent Endometriose."
Bereits im Frühjahr 2023 hatte ein deutsches Privatlabor einen Speicheltest zum Nachweis einer Endometriose-Erkrankung auf den Markt gebracht. Dabei werden Gen-Bestandteile im Speichel auf Endometriose-spezifische Muster untersucht. Die Kosten von rund 800 Euro müssen die Patientinnen jedoch selbst tragen. Der Speicheltest wurde bisher nur an 200 Frauen getestet. Damit ihn die Krankenkassen bezahlen, muss sein Nutzen durch weitere Studien ausreichend belegt sein.
Für ein Folgeexperiment erzeugten die Forschenden der University of Houston Endometriose künstlich in den Körpern von Mäusen. Dann verabreichten sie den Tieren das Stoffwechselprodukt 4-Hydroxyindol, das sie zuvor in den Stuhlproben der Endometriose-Betroffenen nachgewiesen hatten. Zumindest bei den Versuchstieren führte dies zu einer signifikanten Reduktion der Endometrioseherde im Vergleich zur Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse ließen sich jedoch nur sehr begrenzt auf den Menschen übertragen, sagte Dunja Baston-Büst von Universitätsklinikum Düsseldorf dem SMC. Weitere Untersuchungen seien wünschenswert.
Endometriose ist eine chronische Erkrankung und gilt bislang als nicht heilbar. Die Betroffenen können lediglich die Symptome lindern. Manchen Patientinnen rate sie deshalb zur Einnahme niedrig dosierter Hormonpillen, sagt die Berliner Gynäkologin Mechsner: um die Periode zu unterdrücken. Schwerwiegend Erkrankte müssten sich sogar immer wieder operativen Eingriffen unterziehen, bei denen Endometrioseherde, Verklebungen und Verwachsungen entfernt werden.
Wie Endometriose im weiblichen Körper entsteht, können Fachleute bislang nur vermuten. So könnten sich bei betroffenen Frauen etwa während der Regelblutung Mikrorisse in der Gebärmutterwand bilden, etwa durch starke Kontraktionen der Gebärmutter. Dabei werden Stammzellen aktiviert, wandern in den Bauchraum und bilden dort neue Gebärmutterzellen. Diese Endometrioseherde sind von heftigen Entzündungen im Bauchraum begleitet und verursachen die mitunter kaum erträglichen Schmerzen der Betroffenen.