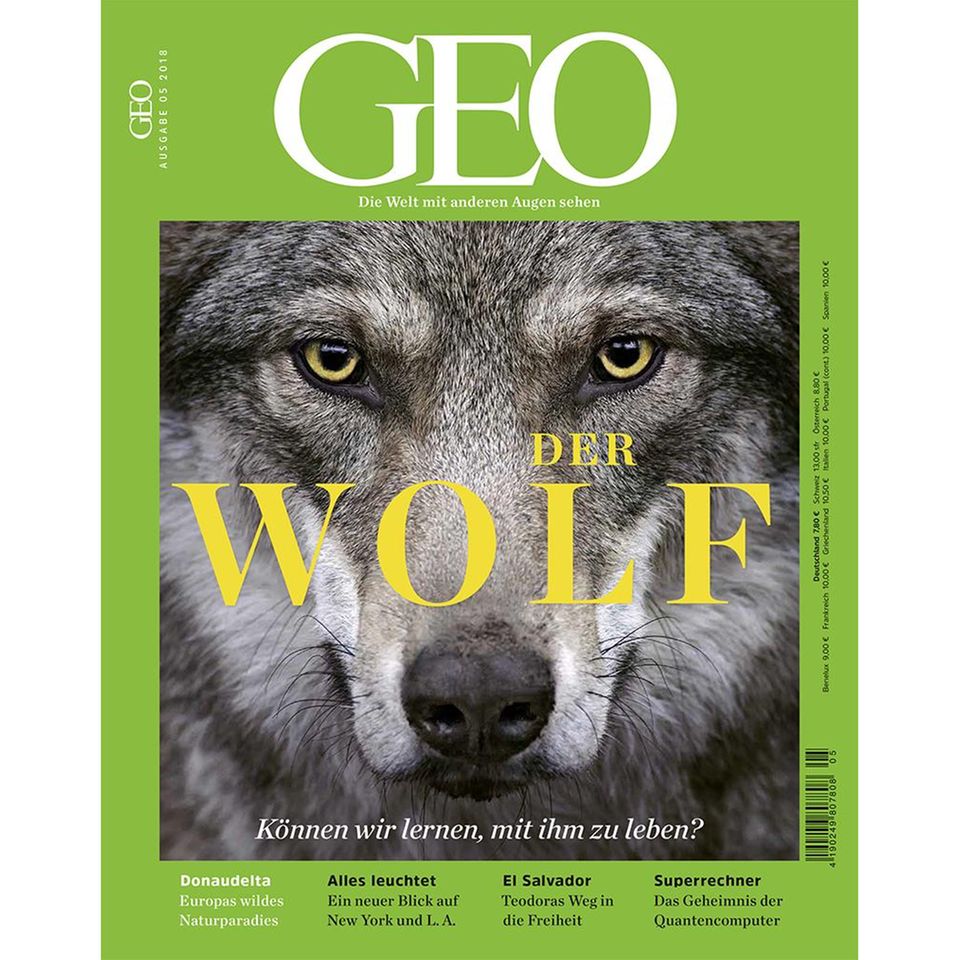Ein kleines Mädchen kämpft um ihr Leben. Die Mediziner sind ratlos. Alles ist getan. Keine Besserung in Sicht. Wenig Zeit bleibt. Verzweiflung steht den Eltern im Gesicht. „Ich werde aber erst sterben, wenn der Baum vor meinem Fenster keine Blätter mehr hat“, so verkündete das Mädchen im Sommer.
Dann ist es Herbst, und der Baum vor Station 4 beginnt sein Laub abzuwerfen. Das Mädchen spricht jede Nacht mit ihm und erzählt dabei von Träumen, die sie den Eltern lieber verschweigt. Nur noch ein Blatt am Baum. Jeden Morgen reißt sie die Augen auf, um dieses zu erspähen. Es hängt noch. So geht das den ganzen Winter über. Zum Erstaunen aller hat sich das kleine Mädchen ein wenig erholt, es kann zum Fenster gehen und nach dem Blatt sehen. Erstaunt ruft sie: „Mein Blatt ist gar kein Blatt. Nur ein alter kaputter Luftballon, der sich in den Zweigen verheddert hat!“
Großteil unserer Wahrnehmung eine Lüge
Der Großteil unserer Wahrnehmung ist alles andere als wahr. Streng genommen ist er vielmehr eine Lüge. Oder, wissenschaftlich betrachtet, das Produkt einer neuronalen Interpretation unserer Umwelt, bei der die Sinneseindrücke physio- und psychologisch sowie sozio-kulturell gefiltert werden.
Es sind genau diese Filter, die unsere Wahrnehmung zu einer persönlichen, individuellen Wahrnehmung machen. Auch Krankheit filtert. Ein kaputter Ballon wird in den Augen des kranken Mädchens zu einem Blatt. „Der Wunsch ist Vater des Gedankens“ besagt ein altes Sprichwort. Wünschen und Hoffen sind lediglich zwei Elemente aus einer riesigen Palette psychischer Befindlichkeiten, die unsere Wahrnehmung beeinflussen.
Denken Sie zurück an die Zeit, in der Sie Ihr erstes Kind erwarteten und Ihnen plötzlich schien, als seien die Straßen voller Kinderwagen. Oder an den Weg zum neuen Urlaubsdomizil, der Ihnen beim ersten Reisen deutlich länger vorkam als die folgenden Male. Während die Füße immer die gleiche Anzahl Schritte zählen, wird der „Kopf“ ungeduldig und belegt die Wahrnehmung der Strecke mit seinem Werturteil: „Das ist mir zu lang!“
Der Blick ins Freie lindert Schmerzen
Wenn psychisches Befinden unsere Wahrnehmung zu verändern vermag, kann dann im Umkehrschluss Wahrnehmung auch unser Befinden verändern? Gar einen Einfluss auf unsere körperliche und seelische Gesundheit ausüben? Kann das kleine Mädchen genesen, weil wir ihr eine Umgebung anbieten, die als Projektionsfläche für ihre Wünsche taugt? Die ein lebendiges Gegenüber bietet, das in ihrer Fantasie Leiden mit ihr teilt? Die dynamisch und offen genug ist, um eine Lebendigkeit zu assoziieren?
Diese Fragen bewegen die moderne Architekturpsychologie. Schon im Jahr 1984 weist der amerikanische Forscher Roger Ulrich bei Frischoperierten, deren Patientenzimmer nur die Sicht auf eine Mauer gewährt, einen messbar höheren Schmerzmittelbedarf nach als bei der Vergleichsgruppe, deren Sicht ins Freie weist.
Der schwedische Forscher Per-Olof Sandman beschreibt 2006 eindrucksvoll, wie sich das psychische Empfinden Schwerstkranker ändert, wenn sie sich abwärts zu ihren Behandlungsräumen bewegen, anstatt diese ebenerdig zu erreichen. „Ich steige in meine Gruft hinab“ ist eines der häufigsten Patientenzitate in seiner Studie. 2010 kann meine niederländische Forschungsgruppe erstmals prospektiv aufzeigen, dass Krebsbetroffene hohe Stresswerte aufweisen, weil sie abhängig von der Gestaltungsqualität Räume dunkler, enger und überfüllter empfinden als ihre gesunden Partner.
Räume sind Stressfaktoren
Räume erweisen sich als Stressoren. Sie steigern auf gefährliche Weise die Tendenz, eine lebenswichtige Therapie abzubrechen, und sie wirken sich zudem negativ auf die Anzahl der Nebenwirkungen aus.
In Deutschland spielen solche Erkenntnisse bei der Planung und Gestaltung von Krankenhäusern leider kaum eine Rolle. Zwar wird der Begriff „Healing Architecture“ immer häufiger verwendet. Am Ende stehen jedoch stets Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Flexibilität als Gestaltungsprämissen im Gesundheitsbau im Vordergrund.
Faktoren einer genesungsunterstützenden Architektur sind hierzulande keine Bewertungskriterien in Architekturwettbewerben. In der Übertragung einer antiquierten Sicht auf Architektur im Gesundheitsbau werden vielmehr die Anforderungskriterien der Antike hochgehalten: firmitas, utilitas, venustas. Festigkeit, Nützlichkeit, Schönheit also: Unverwüstlich und gesund, nützlich, gewinnbringend und schön, so soll sie sein, die Behausung des Menschen.
Vernachlässigt und fatal für ein Voranschreiten im modernen Krankenhausbau bleibt bei dieser Sicht, dass der Mensch Veränderungen unterliegt. Eine schwere oder chronische Erkrankung ist solch eine Veränderung; eine Verformung unserer (Körper-)Wirklichkeit, die sich mit eindrucksvoller Wucht auch auf den architektonischen Raum auswirkt.
Wenn wir nämlich begreifen müssen, dass es eine Unverwüstlichkeit unseres Körpers nicht gibt, am Ende alle Nützlichkeit unnütz und alle Schönheit vergänglich ist, verändern sich Wahrnehmung und Bedürfnisse. Spätestens dann sollte meiner Ansicht nach Architektur an ganz neuen Maßstäben gemessen werden: an denen, die den äußeren Bedarf den inneren Bedürfnissen unterordnen und Leid als den Gestaltungsursprung einer „heilenden Umgebung“ begreifen.
Tanja C. Vollmer ist Mitgründerin des Architekturbüros kopvol architecture & psychology, seit 2016 Gastprofessorin für Architekturpsychologie und Gesundheitsbau zunächst an der Technischen Universität Berlin und seit 2019 an der Fakultät für Architektur der TU München.