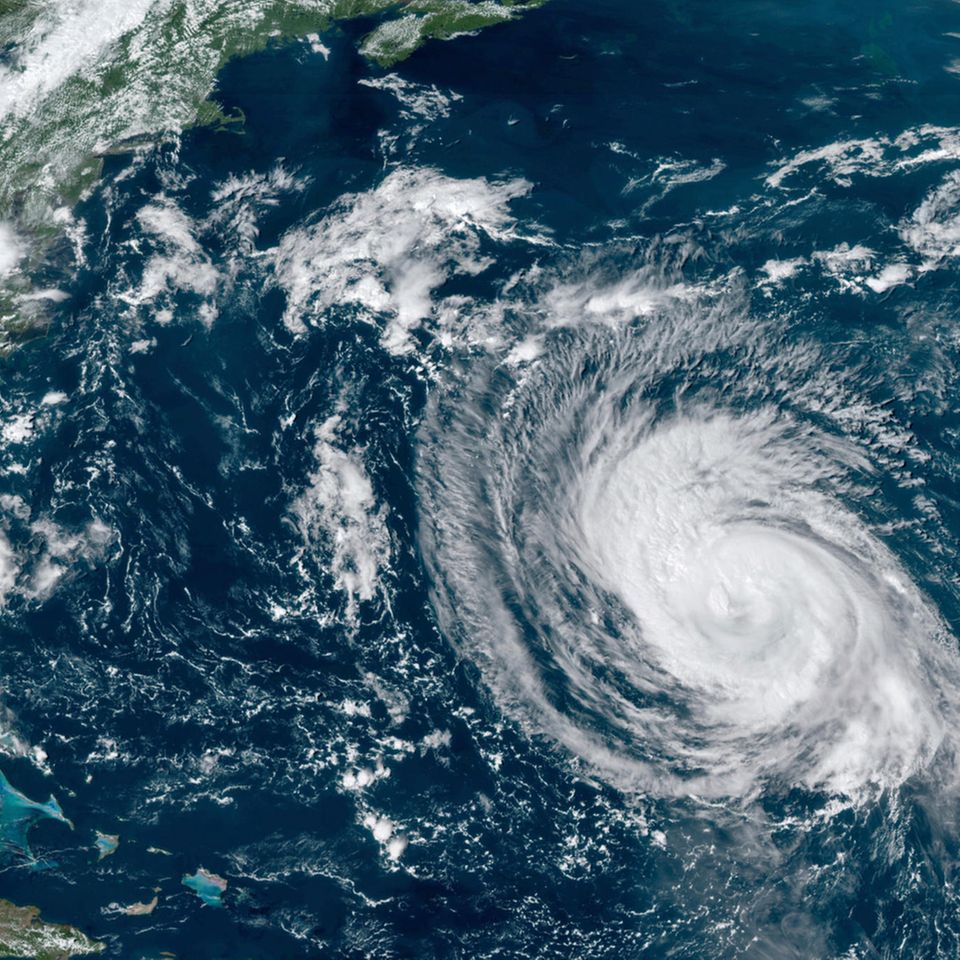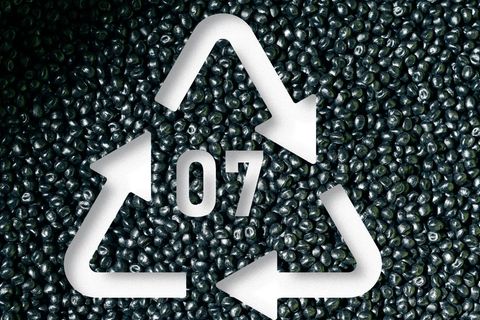Als eine Lösung im Kampf gegen immer mehr Plastikmüll in der Umwelt gilt das möglichst umfassende Recycling von Kunststoffen. Doch es gibt ein Problem: Recycelter Kunststoff kann eine ganze Reihe gefährlicher Stoffe enthalten, wie die Analyse eines Forschungsteams um Bethanie Carney Almroth von der Universität Göteborg und Eric Carmona vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig kürzlich ergab. Recycelte Kunststoffe seien daher für die meisten Zwecke ungeeignet und eine echte Kreislaufwirtschaft so zunächst nicht möglich, lautet sein Fazit.
Ein Grundproblem sei, dass es zwar einige nationale und regionale Vorschriften für die zulässigen Konzentrationen gefährlicher Chemikalien in bestimmten Kunststoffprodukten gebe, aber weniger als ein Prozent der Kunststoffchemikalien internationalen Vorschriften unterlägen, heißt es. Mit Kunststoffabfällen werde international gehandelt, eine umfassende Überwachung von Chemikalien in recycelten Materialien finde nicht statt.
Zusätzliche Auflagen benötigt
In der EU unterliegen die Bausteine der Kunststoffe sowie die zugesetzten Hilfsstoffe der EU-Chemikalienverordnung REACH, wie es vom Umweltbundesamt (UBA) heißt. Ihr Risiko für Mensch und Umwelt müsse jeweils geprüft werden. Richtig sei aber, dass bei Recyclingkunststoff noch zusätzliche Auflagen benötigt würden, da zum Beispiel unter REACH Verunreinigungen möglicherweise nicht ausreichend betrachtet würden. "Daneben ist es zutreffend, dass im globalen Kontext noch viel zu tun ist." Generell aber sei Kunststoffrecycling ein notwendiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, betont UBA-Expertin Ines Oehme.
Das Team um Almroth und Carmona hatte Pellets aus recyceltem Kunststoff aus Recyclinganlagen 13 verschiedener Länder in Afrika, Südamerika, Asien und Osteuropa untersucht. Insgesamt wurden 28 Granulatproben von recyceltem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) sowie zum Vergleich ein aus neuem HDPE hergestelltes Pellet analysiert. Die Pellets aus recyceltem HDPE enthielten demnach hunderte giftige Chemikalien, darunter hochgiftige Pestizide sowie Arzneimittel. Weitere der insgesamt über 600 identifizierten chemischen Verbindungen waren Industriechemikalien und Kunststoffadditive.
Bestimmte Chemikalien wie N-Ethyl-o-Toluensulfonamid, ein bei der HDPE-Verarbeitung verwendeter Weichmacher, seien in allen Produkten gefunden worden, hieß es. Die Chemikalie mit der zweithöchsten Häufigkeit sei der Gummizusatzstoff N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin gewesen, schreiben die Forschenden im Fachjournal "Data in Brief". Giftige Chemikalien werden demnach zum einen bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet, zudem können diese während ihrer Verwendung chemische Substanzen absorbieren.
Der untersuchte Kunststoff HDPE sei anders als etwa PET sehr aufnahmefähig für Stoffe, erklärt UBA-Expertin Oehme zu den Ergebnissen. "Das heißt, Stoffe können sehr leicht in den Kunststoff migrieren und sind dort auch nur schwer wieder vollständig herauszubekommen." Auf andere Kunststoffe seien die Ergebnisse der Studie daher nicht direkt übertragbar.
Verunreinigungen an vielen Stellen möglich
Was jeweils die Ursache für die Verunreinigung der Rezyklate – insbesondere für die Funde an Pestiziden – war, lasse sich nur vermuten, da diese an vielen Stellen der Wertschöpfungskette stattfinden könne. Im konkreten Fall sei das besonders schwierig, da die Abfallströme nicht bekannt seien, aus denen die Rezyklate gewonnen wurden, sagt die Leiterin des UBA-Fachgebiets Kunststoffe und Verpackungen. Als Ursache infrage kommen demnach etwa die Fehlentsorgung von Behältern für Pestizidprodukte oder andere gefährliche Stoffe, die Umfüllung solcher Substanzen durch Kleinanwender etwa in HDPE-Flaschen mit anschließender Sammlung für ein Recycling oder eine Verunreinigung unbelasteter Kunststoffabfälle während Transport und Lagerung.
Insgesamt werden dem Team um Almroth und Carmona zufolge rund 13 000 Chemikalien bei der Herstellung von Kunststoffen und Kunststoffprodukten verwendet. Ein Viertel davon werde als gefährlich eingestuft. Für tausende Chemikalien lägen noch keine Daten vor, nicht einmal grundlegende toxikologische Angaben.
Das Wissen um potenzielle Gefahren von Stoffen sei nie endgültig, sondern immer Erkenntnisstand zum jeweiligen Zeitpunkt, erklärt Oehme. Der Datenbestand stehe dabei in Bezug zu den jeweiligen regulatorischen Anforderungen. In der EU hängen die von den Unternehmen einzureichenden Informationen Oehme zufolge wiederum von den Mengen des Stoffes ab, die jedes Jahr dort hergestellt oder importiert und auf den Markt gebracht würden. Bei Mengen zwischen einer und zehn Tonnen pro Jahr seien nur einfache Studien zum Screening auf bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale gefordert, die bestenfalls Hinweise auf potenzielle Effekte auf Mensch oder Umwelt und die darin lebenden Organismen gäben.
Gefährliche Stoffe auch in geschlossenen Kreislauf-Systemen möglich
Im Fachjournal "Science" erläuterten Forschende kürzlich, dass sich Studien zufolge selbst in relativ geschlossenen Kunststoff-Recyclingsystemen wie für Polyethylenterephthalat (PET) in Lebensmittelqualität gefährliche Stoffe ansammeln können. Recyclern fehlten oft die Instrumente und Informationen, um diese Chemikalien in den Abfallströmen zu identifizieren und aus den Kunststoffprodukten zu entfernen. "Die gefährlichen Chemikalien stellen ein Risiko für die Beschäftigten und die Verbraucher beim Recycling sowie für die Gesellschaft und die Umwelt im Allgemeinen dar", schreiben die Forschenden unter anderem von der Universität Göteborg und dem Umwelt- und Gesundheitsschutz-Netzwerk International Pollutants Elimination Network (IPEN).
Aufgrund der vielfältigen Herkunft und einer stark variierenden Zusammensetzung von Kunststoffabfällen nach Gebrauch sei es schwierig herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß gefährliche Stoffe enthalten sind, erklärt Oehme. Eine gute Kenntnis der Abfallquelle sowie ein gutes Qualitätsmanagement seien deshalb nötig. Rezyklate etwa für den Kosmetik- oder Lebensmittelbereich müssten einem aufwändigeren Aufbereitungsprozess unterzogen werden als für eine Palisade oder ein Abwasserrohr. "Für den Einsatz in Kosmetikverpackungen entwickelt die Branche derzeit zum Beispiel einen Standard."
Recycling gelte in der EU als Stoffherstellung – die produzierten Materialien unterlägen also den gleichen Regulierungen wie die Ausgangsstoffe und es müsse die sichere Verwendung dargelegt werden, erklärt Oehme. Es gelte jedoch das sogenannte Recyclingprivileg unter REACH: "Demnach gilt das rezyklierte Material als vergleichbar mit dem Primärkunststoff und zum Beispiel Verunreinigungen müssen nicht erneut geprüft werden, solange das Basismaterial mindestens 80 Prozent des Recycling-Kunststoffs ausmacht." Daher sei nicht auszuschließen, dass es zur Verbreitung von gefährlichen Stoffen über Kunststoffrezyklate kommen könne. Entsprechend groß sei die Verantwortung und die Sorgfaltspflicht aufseiten der Abfallerzeuger, -verarbeiter und Anwender von Recyclingmaterialien.
Schädliche Chemikalien sollten reduziert werden
Bevor Recycling wirklich einen Beitrag gegen Verschmutzung mit Plastikmüll leisten könne, müsse die Kunststoffindustrie gefährliche Chemikalien einschränken, heißt es im "Science"-Beitrag. Ein Weg sei die Verringerung der großen Zahl von Chemikalien, die bei der Kunststoffherstellung verwendet werden. Und: "Chemische Zusatzstoffe, von denen bekannt ist, dass sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden, müssen rasch aus dem Verkehr gezogen werden."
Die Auswahl der Zusatzstoffe richte sich vor allem nach der beabsichtigten Wirkung im Material, erklärt Oehme dazu. Werde einer verboten, können demnach strukturell ähnliche Stoffe zum Einsatz kommen, die vergleichbare gefährliche Eigenschaften haben können.
In Deutschland habe die Kunststoffindustrie im Jahr 2021 insgesamt 14 Millionen Tonnen Kunststoffe zu Produkten verarbeitet, heißt es vom Umweltbundesamt unter Bezug auf die Studie "Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland", die alle zwei Jahre von der Industrie durchgeführt wird. Davon seien etwas mehr als 1,6 Millionen Tonnen recycelte Kunststoffe aus Industrie- und Verbraucherabfällen gewesen.
Kosten für Analysen hoch
Zum Einsatz kämen Rezyklate insbesondere im Baubereich sowie bei Verpackungen und in der Landwirtschaft, erklärt Oehme. Typische Bauprodukte seien etwa Kabelschutz- und Drainagerohre, Fenster- und Türprofile sowie Baufolien. Bei Verpackungen zählten PET-Getränkeflaschen, Shampoo- und Duschgelflaschen sowie Tragetaschen dazu, im Bereich Landwirtschaft Blumentöpfe und Pflanzkübel, Folien und Hochbeete.
Dabei hätten recycelte Kunststoffe Regelungen des Produktrechts einzuhalten. "Wenn Spielzeug aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird, sind die Kosten für die dann notwendige analytische Prüfung jeder Charge Recyclingmaterials hoch", sagt Oehme. Die Inputströme sollten dann gut überwacht werden. "Lebensmittelverpackungen wie Getränkeflaschen oder Becher sind auf Grund ihrer Unbedenklichkeit zum Beispiel ein begehrter Inputstrom."
Für außerhalb der EU hergestellte Spielzeuge seien die Anforderungen zwar gleich, schwierig sei aber die Überprüfung: Eine umfassende Kontrolle sei mit Blick auf die breit gestreuten Warenströme und die großen Warenmengen nicht realisierbar, sagt Oehme. Jedoch gelte dies letztlich auch für Neuware.