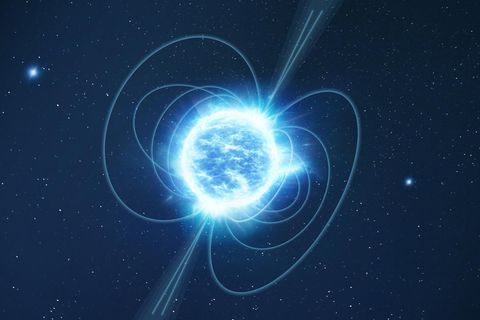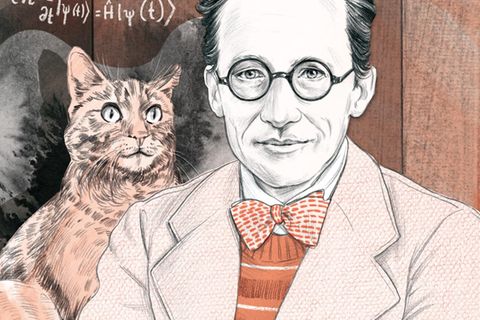Steine ableckende Wissenschaftler, gezählte Nasenhaare und methodisch untersuchte Langeweile: Auch in diesem Jahr wurden wieder in den USA die "Ig-Nobelpreise" vergeben (gesprochen "ignoble", was übersetzt etwa unehrenhaft heißt). Sie prämieren wissenschaftliche Studien, die "erst zum Lachen und dann zum Denken anregen" sollen.
Die traditionell skurrile Preisverleihung wurde in der Nacht zum Freitag abgehalten. Die zum 33. Mal verliehenen undotierten Spaßpreise sollen nach Angaben der Veranstalter "das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren".
Warum Wissenschaftler Steine ablecken
So erhielten beispielsweise Forschende aus Polen und den USA den Preis in der Kategorie "Chemie und Geologie" für ihre Erforschung der Frage, warum viele Wissenschaftler gerne Steine ablecken. Es bereite ihm große Freude, den Preis für so eine "fundamentale Sache" zu bekommen, sagte Forscher Jan Zalasiewicz. "Geologen machen das die ganze Zeit, weil etwas, das nicht ganz klar ist, deutlich klarer wird, wenn die Oberfläche nass ist."
Ein Forschungsteam aus Argentinien, Spanien, Kolumbien, Chile, China und den USA erhielt eine der zehn Auszeichnungen für die Erforschung der Gehirnaktivität von Menschen, die Profis im Rückwärtssprechen sind. "Danke für diesen spaßigen Preis, wir freuen uns, ihn anzunehmen", sagten die Wissenschaftlerin María José Torres-Prioris und ihr Kollege Adolfo García – vorwärts und rückwärts.
Wann Schüler gelangweilt sind
Forschende aus China, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Irland, den USA und Japan erhielten einen Preis in der Kategorie "Bildung" für ihre methodische Untersuchung der Langeweile bei Lehrer*innen und Schüler*innen. Unter anderem sei es wahrscheinlicher, dass Schüler*innen im Unterricht gelangweilt seien, wenn sie das schon im Vorfeld erwarteten, sagte das Forschungsteam in seiner Dankesrede. Außerdem seien Schüler*innen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im Unterricht gelangweilt, wenn sie den Eindruck hätten, dass der Lehrer oder die Lehrerin gelangweilt sei.
Forschende aus Frankreich, Großbritannien, Malaysia und Finnland bekamen eine Auszeichnung für ihre Untersuchung, welche Emotionen Menschen empfinden, wenn sie ein Wort oft, oft, oft, oft, oft, oft, oft, oft wiederholen. Ein Team aus den USA erhielt einen Preis für Experimente auf den Straßen einer Stadt, bei denen sie herausfinden wollten, wie viele Passanten anhalten und nach oben schauen, wenn sie fremde Menschen nach oben schauen sehen.
Was ausgeschiedene Substanzen verraten
Ein südkoreanisch-amerikanischer Forscher erfand die sogenannte Stanford-Toilette – ein Klo, das mittels verschiedener Hilfsmittel die von Menschen ausgeschiedenen Substanzen analysiert. Die Toilette umfasst unter anderem einen Urin-Teststreifen, ein Computer-Vision-System für die Defäkationsanalyse, einen Sensor für den Analabdruck, der mit einer Identifizierungskamera gekoppelt ist, sowie eine Telekommunikationsverbindung. "Verschwendet eure Ausscheidungen nicht", sagte Forscher Seung Min Park bei seiner kurzen Dankesrede zur Preisvergabe.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Indien, China, Malaysia und den USA belebten tote Spinnen wieder, um sie als mechanische Greifwerkzeuge zu benutzen – und wurden dafür ebenfalls ausgezeichnet. Fachleute aus den USA, Kanada, dem Iran und Vietnam wurden prämiert für die Frage, ob ein Mensch die gleiche Anzahl von Haaren in beiden Nasenlöchern hat. Sie hätten an rund 20 Leichen geforscht und pro Nasenloch etwa 110 bis 120 Haare gefunden, teilten die Forschenden in ihrer Dankesrede mit.
Wieso Sardellen-Sex interessant ist
Geehrt wurden zudem ein Forscher und eine Forscherin aus Japan für ihre Experimente zu der Frage, ob elektrische Essstäbchen und Strohhalme den Geschmack von Nahrungsmitteln verändern können. Außerdem ging ein Preis an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Spanien, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien für die Erforschung der Frage, inwiefern sich die sexuelle Aktivität von Sardellen im Durchmischen von Meereswasser niederschlägt.
Vor der Corona-Pandemie war die Gala – an der auch echte Nobelpreisträger teilnehmen, darunter in diesem Jahr der deutsche Physiker Wolfgang Ketterle – alljährlich von mehr als 1000 Zuschauern in einem Theater der Elite-Universität Harvard verfolgt worden.
Aber auch bei der rund anderthalbstündigen Online-Preisverleihung, die diesmal unter dem Oberthema "Wasser" stand, flogen Papierflieger, gab es Sketche, bizarre Kurz-Musikstücke und noch viel mehr skurrilen Klamauk - beendet von den traditionellen Abschlussworten des Moderators Marc Abrahams, Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu kurioser Forschung: "Wenn Sie dieses Jahr keinen Ig-Nobelpreis gewonnen haben, und besonders dann, wenn Sie einen gewonnen haben: mehr Glück im nächsten Jahr!"