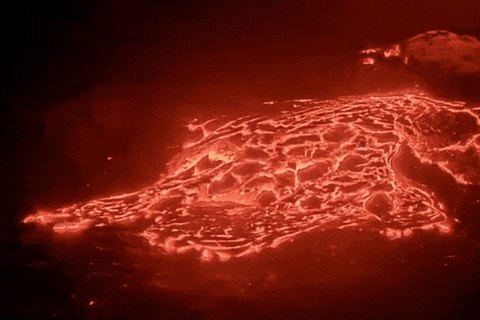Wenn Gletscher weltweit schmelzen, drohen nicht nur lebenswichtige Wasserreservoire zu versiegen: Wie Forschende berichten, könnte die Eisschmelze zu mehr Vulkanausbrüchen führen – was wiederum den Klimawandel weiter anheizt.
Das Team der Universität von Wisconsin-Madison, USA, untersuchte in Patagonien, im Süden Chiles, einen Komplex von sechs Vulkanen. Besonderes Augenmerk legten sie auf den Zusammenhang zwischen Eisbedeckung und vulkanischer Aktivität. Analysen von Eruptivgestein zeigten, dass der Eispanzer während des Maximums der jüngsten Kaltzeit, etwa vor 26.000 bis 18.000 Jahren, vulkanische Aktivität buchstäblich unterdrückt haben musste – während sich in einer Tiefe von zehn bis 15 Kilometern unter der Erdoberfläche kieselsäurereiches Magma sammelte.
Das rasche Schmelzen des Gletschereises am Ende der Kaltzeit führte dann zu einer Entlastung der Magmakammern. Gase im flüssigen Gestein dehnten sich aus, der steigende Druck trieb das Magma an die Erdoberfläche – und ließ in der Folge die Vulkane des Komplexes entstehen, darunter den derzeit schlafenden Vulkan Mocho-Choshuenco.
"Gletscher neigen dazu, das Volumen der Eruptionen der unter ihnen liegenden Vulkane zu unterdrücken", erklärt der Geologe Pablo Moreno-Yaeger in einer Pressemitteilung. Da sich die Gletscher aufgrund des Klimawandels zurückziehen, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass solche Vulkane häufiger und explosiver ausbrechen werden."

Forschende befürchten negative Rückkopplungsschleife
Schon in den 1970er-Jahren hatten Forschende am Beispiel Islands den Zusammenhang zwischen Eisbedeckung und Vulkanismus nachgewiesen. "Unsere Studie deutet darauf hin, dass dieses Phänomen nicht auf Island beschränkt ist", sagt Moreno-Yaeger. Auch andere kontinentale Regionen wie Teile Nordamerikas, Neuseelands und Russlands verdienten nun eine genauere wissenschaftliche Betrachtung.

Creative Commons
Besonders problematisch an dem Phänomen ist ein negativer Rückkopplungseffekt: Zwar führen einzelne Vulkanausbrüche zu einem Rückgang der globalen Temperatur. So führten Aerosole, die der Pinatubo auf den Philippinen bei seinem Ausbruch im Jahr 1991 in die Atmosphäre schleuderte, zu einer weltweiten Abkühlung um etwa 0,5 Grad Celsius. Der Grund: Die Partikel reflektierten die Strahlung der Sonne ins All. Häufen sich jedoch die Eruptionen, verkehrt sich der Effekt durch die Ansammlung von Treibhausgasen in der Atmosphäre in sein Gegenteil.
Durchschnittlich verlieren die Eisriesen Grönlands, der Hochgebirge und der Antarktis jedes Jahr mehr als 300 Milliarden Tonnen. Und die Schmelze beschleunigt sich mit steigenden Temperaturen. Allein seit dem Jahr 2000 haben die Gletscher der Erde rund fünf Prozent ihres Gesamtvolumens verloren.