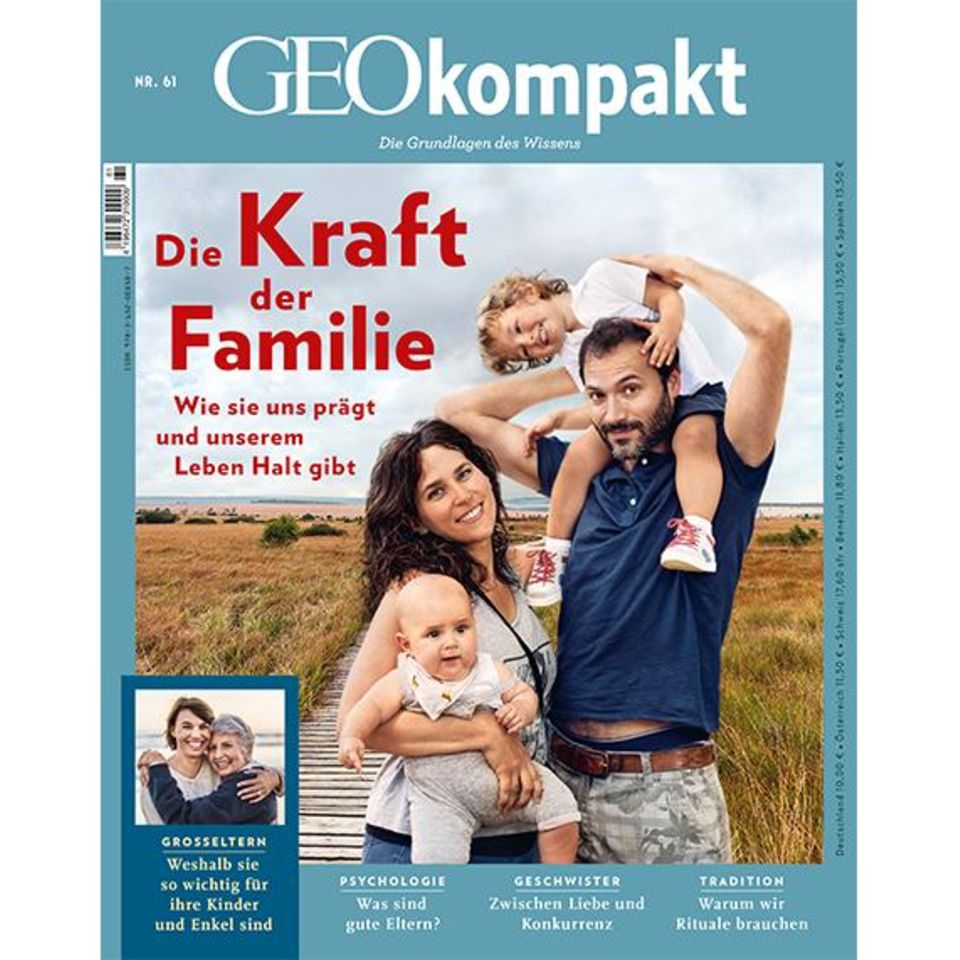Wir sind, in unserer Familie, anfangs gläubig gewesen, dann ging uns der Glaube verloren. Irgendwann sind alle aus der Kirche ausgetreten, sogar meine Großeltern. Trotzdem haben wir natürlich weiterhin Weihnachten gefeiert. Die meisten Ungläubigen tun das. Es gab den Baum, dann bimmelte das Glöckchen, die Geschenke wurden verteilt. Es gab immer das Gleiche zu essen, eine Gans.
Als ich erwachsen war und eine eigene Familie hatte, gingen wir außerdem an Heiligabend immer in die Kirche. Wir fanden das irgendwie passend, wir mochten das. Es gehört halt dazu, egal ob du gläubig bist oder nicht.
Inzwischen habe ich eine andere Familie und einen kleinen Sohn. Ich habe ihn taufen lassen, aber als Begründung fällt mir wieder nur dieser blöde Satz ein: Es gehört halt dazu. Es ist, in meiner Sicht, ein Willkommen – in der Welt, in unserer Gesellschaft, in der Familie. Gibt es eine Alternative? Es muss so ein Ritual geben, das spürt man doch, ein Leben muss einen festlichen Anfang haben, ähnlich wie die Trauerfeier am Schluss. Da will man den Verstorbenen doch auch nicht einfach kommentarlos einbuddeln.
Was die Bedeutung von Ritualen für das Familienleben betrifft, sind die Experten sich einig. Rituale kommen sogar im jüngsten Familienbericht der Bundesregierung vor: „Für die Qualität des Familienlebens sind vorhersehbare Abläufe und Rituale wichtig.“ Es sind nicht nur die Feste, die damit gemeint sind, zum Beispiel der erste Schultag mit der Schultüte oder die Abiturfeier – Rituale geben auch dem Alltag eine Struktur, gemeinsame Mahlzeiten, das Zubettgehen mit der immer gleichen Zeremonie, zum Beispiel Vorlesen. Immer noch lesen sehr viele Eltern in Deutschland ihren Kindern vor dem Einschlafen vor. Die meisten Deutschen sind auch der Ansicht, dass regelmäßiges gemeinsames Essen ein wichtiger Faktor für familiäres Glück ist.
Weshalb ist das so? Die amerikanische Ritualforscherin Barbara Fiese hat die Botschaft der Rituale in drei, wie ich finde, wunderbaren Sätzen zusammengefasst: „This is who we are. This is right. This is what we look forward to and who we will continue to be across generations.“ Sinngemäß bedeuten sie: Das sind wir. Das ist richtig. Und so wird es bleiben.
Rituale geben also eine Antwort auf eine der ältesten aller Menschheitsfragen: Wer bin ich? Indem wir gemeinsam etwas tun, immer wieder, als Ritual, stellen wir Gemeinschaft her. Das Individuum wird sich im Ritual der Tatsache bewusst, Teil von etwas zu sein.
So etwas findet nicht nur innerhalb einer Familie statt. Im Kindergarten setzen sich die Kinder in einem Stuhlkreis zusammen. Sie sagen, zum Beispiel, an jedem Morgen im Chor: „Guten Morgen.“
In manchen Ländern wird zum Schulbeginn sogar die Landesflagge gehisst und die Landeshymne gesungen. Es werden Amtseide geschworen, Rekruten vereidigt. Auf Kreuzfahrtschiffen feiern sie die Äquatortaufe, im Karl-May-Roman schließt Old Shatterhand mit Winnetou Blutsbrüderschaft, im Mainzer Karneval wird seit Jahrzehnten die große Fernsehsitzung mit dem gleichen Lied beendet.
Und wenn irgendwo auf der Welt gegen die USA protestiert wird, dann kann man sich darauf verlassen, dass die Demonstranten die US-Flagge verbrennen, auch das ist ja eine Art Ritual.

Rituale brachten evolutionäre Vorteile - sie stifteten Gemeinschaft
Es gibt also nette und harmlose Rituale, kriegerische und aggressive, familiäre und staatliche, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie stiften Gemeinschaft.
Im Ritual lernen wir, wie es der Literatur- und Kulturwissenschaftler Burckhard Dücker formuliert hat, eine Gruppe zu bilden und zu stärken; das Ritual ist ein Mittel zur „Binnenintegration“ und „Außenabgrenzung“. Der evolutionäre Vorteil, den Rituale bieten, liegt auf der Hand: Bei unseren Vorfahren hatten diejenigen, die in einer Gruppe fest verankert waren, größere Überlebenschancen als Einzelgänger. In den Kulturwissenschaften gelten solche Traditionen als anthropologische Konstante, das heißt: Es gibt wahrscheinlich keine Kultur, die ohne Rituale auskommt.
Manche Rituale sind universell, jeder versteht sie sofort. Der Kniefall ist ein Beispiel dafür. Als Willy Brandt im Dezember 1970 in Warschau vor dem Denkmal der polnischen Widerstandskämpfer auf die Knie ging, konnte jeder Mensch diese Botschaft begreifen, überall.
Ein berühmtes Beispiel für die Kraft der Rituale gab es im Ersten Weltkrieg, an Heiligabend 1914, als deutsche und britische Soldaten ihre Schützengräben verließen und gemeinsam Weihnachten feierten, als Friedensfest.

Das Ritual schafft eine Atmosphäre der Besonderheit
Und nicht wenige Homosexuelle legen Wert darauf, zu heiraten. Aber genügt es denn nicht, akzeptiert zu werden und als Paar ungestört leben zu dürfen? Offenbar nicht. Ich verstehe das gut. Denn anscheinend besiegelt erst das Ritual der Eheschließung in ihren Augen, dass sie vollkommen, ohne jede Einschränkung, dazugehören. Man ist dann nicht mehr „das Fremde“.
Wir brauchen das. Wir brauchen es wirklich. Das Ritual gibt uns Sicherheit, wir spüren, dass wir nicht allein sind, dass es ein Band gibt zwischen uns und den anderen.
In einem Fachbuch über die Eltern-Kind-Beziehung nennt die Autorin Julia Roth Rituale „überlebenswichtig für ein wohltuendes Familienklima“. Nur mithilfe solcher Traditionen könne sich eine Familienidentität entwickeln. Das Ritual, schreibt Julia Roth, schaffe eine Atmosphäre der Besonderheit. Es ist einerseits etwas Außergewöhnliches – nur an Weihnachten bimmelt das Glöckchen, nur am Geburtstag brennen Kerzen auf dem Kuchen. Andererseits ist es normal: Wir tun das immer an diesen Tagen, genau das ist bei uns üblich, und ich kann mich darauf verlassen, dass es zu diesem Anlass immer so abläuft.
Ohnehin lieben Kinder Wiederholungen. Alle Eltern wissen das. Die Kleinen wollen immer wieder die gleiche Geschichte hören, sie wollen immer wieder das Gleiche essen. Kinder ändern sich ständig, mit jedem Tag, vielleicht haben sie auch deshalb diese Sehnsucht nach einer Welt, die beständig ist und auf die sie sich verlassen können.

Alles, was man über Rituale wissen muss, steckt in "Dinner for one"
Ein Ritual, das sich in Deutschland durchgesetzt hat, heißt „Dinner for one“. Es hat weder etwas mit Brauchtum noch mit Religion zu tun, auch nur indirekt mit Familie, obwohl ich mir diesen Sketch jahrelang mit meinem großen Sohn am Silvesterabend im Fernsehen angeschaut habe. Das war und ist sicher in vielen Familien so üblich.
Muss ich den Sketch wirklich erklären? Es geht um eine britische alte Dame, die ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer längst verstorbenen, nur noch virtuell vorhandenen Ex-Liebhaber feiert. Der Butler übernimmt die Rolle sämtlicher Lover und wird dabei immer betrunkener. Wir schauen uns das an, weil wir genau wissen, was kommt. Je häufiger wir die Gags sehen, die im Grunde nur mäßig originell sind, desto mehr erfreuen wir uns an ihnen. Nach ein paar Jahren kennen wir den Dialog auswendig, und genau das ist das Schöne.
Alles, was man über Rituale wissen muss, steckt in „Dinner for one“: die Freude an der Wiederholung, am Sichauskennen, das Gefühl, nicht allein zu sein mit seiner Freude, ein Gefühl von geistiger Heimat, von Sicherheit und Behaglichkeit, das, was Familie ausmacht.
Während der Kinderjahre meines heute 28-jährigen Sohnes nahmen ihn seine Mutter und ich an jedem Geburtstag in unsere Mitte, jeder von uns fasste ihn an einer Hand, wir rannten los, riefen „Engelchen flieg!“, und er schlug, an unseren Händen, in der Luft einen Salto. Wir begannen damit, als er zwei Jahre alt wurde. Und er liebte dieses Ritual so sehr, dass er auch dann noch dafür zu haben war, als er sich längst nicht mehr in der Öffentlichkeit an der Hand nehmen ließ. Wir mussten es tun, wenn niemand in der Nähe war. Ich glaube, er war 15 oder 16, als er zum letzten Mal das fliegende Engelchen war. Das hatte dann, beim Finale, eine ironische Note. Aber es war auch traurig, ein Abschied, ich musste mit den Tränen kämpfen.
Alles auf einen Blick - Rituale
Familienalltag
Gerade für Kinder sind vorhersehbare Abläufe und Rituale wichtig: Sie schaffen ein Gefühl der Sicherheit.
Stammesgeschichte
Traditionen bergen einen evolutionären Vorteil: Rituale stärkten einst das überlebenswichtige Gruppengefühl.
Abwechslung
Rituale schaffen Distanz zum Alltag, denn sie werden trotz ihrer Vorhersehbarkeit wieder und wieder als etwas Besonderes erlebt.
War das überhaupt ein Ritual? Oder nur ein Spiel? Auf der Suche nach einer Definition des Begriffs landet man wieder bei Burckhard Dücker, dem Verfasser einer „Einführung in die Ritualwissenschaft“. Dücker schreibt: „Prinzipiell kann jede Alltagshandlung ritualisiert werden.“ Er zitiert eine Liste von zwölf Merkmalen, die Rituale kennzeichnen, wobei nicht jedes Ritual alle diese Merkmale aufweisen muss.
Es sollte bei einem ordentlichen Ritual zum Beispiel ein festes, unveränderliches Ablaufschema geben und eine gewisse Feierlichkeit. Das Ritual wird regelmäßig wiederholt und hat einen in der Regel genau definierten Kreis der Teilnehmer, dazu eine „dramatische Struktur“ und eine „ästhetische Dimension“. Das heißt wohl, festliche Blumendekoration schadet nicht.
Hinzu kommen im Idealfall noch ein paar kompliziertere Merkmale wie „Vermittlung von Dispositionen zu Anschlusshandlungen im nichtrituellen Bereich“. Die Grenzen des Rituellen sind fließend, aber im Großen und Ganzen war unser alljährlicher Engelchenflug vermutlich schon ein Ritual. Ständig erfinden die Leute ja auch neue, moderne Rituale oder ritualähnliche Verhaltensweisen. Vor ein paar Jahren fing es zum Beispiel mit den Schlössern an, die junge Paare feierlich an Brückengeländern befestigen, ein Liebesritual. Das kommt aber vielleicht wieder aus der Mode, Rituale kommen und gehen. Gewisse religiöse Rituale sind bei uns im Begriff zu verschwinden, das Tischgebet ist selten geworden.

Dann wurde plötzlich die „Ice Bucket Challenge“ populär, auf Deutsch: Eiskübelherausforderung. Menschen kippten sich Eimer mit Eiswasser über den Kopf und spendeten zehn Dollar oder Euro für eine Organisation, die gegen die Nervenerkrankung ALS kämpft. Danach nominierten sie drei oder mehr Personen, die sich ebenfalls der Herausforderung stellen sollten. Wer keine Lust dazu hatte, durfte sich mit einer 100-Euro-Spende von der Herausforderung freikaufen.
Die Beliebtheit der Ice Bucket Challenge hat inzwischen nachgelassen. Eine Zeit lang wurde versucht, eine ähnliche Aktion ins Leben zu rufen, die sich dem Kampf gegen den Hodenkrebs widmet. Da sollte man sich nicht mit Eiswasser benetzen, sondern mit Urin.
Das hat sich nicht durchgesetzt. Also, bei aller Liebe zu Ritualen: Es scheint nicht jedes bei den Menschen gleichermaßen gut anzukommen.