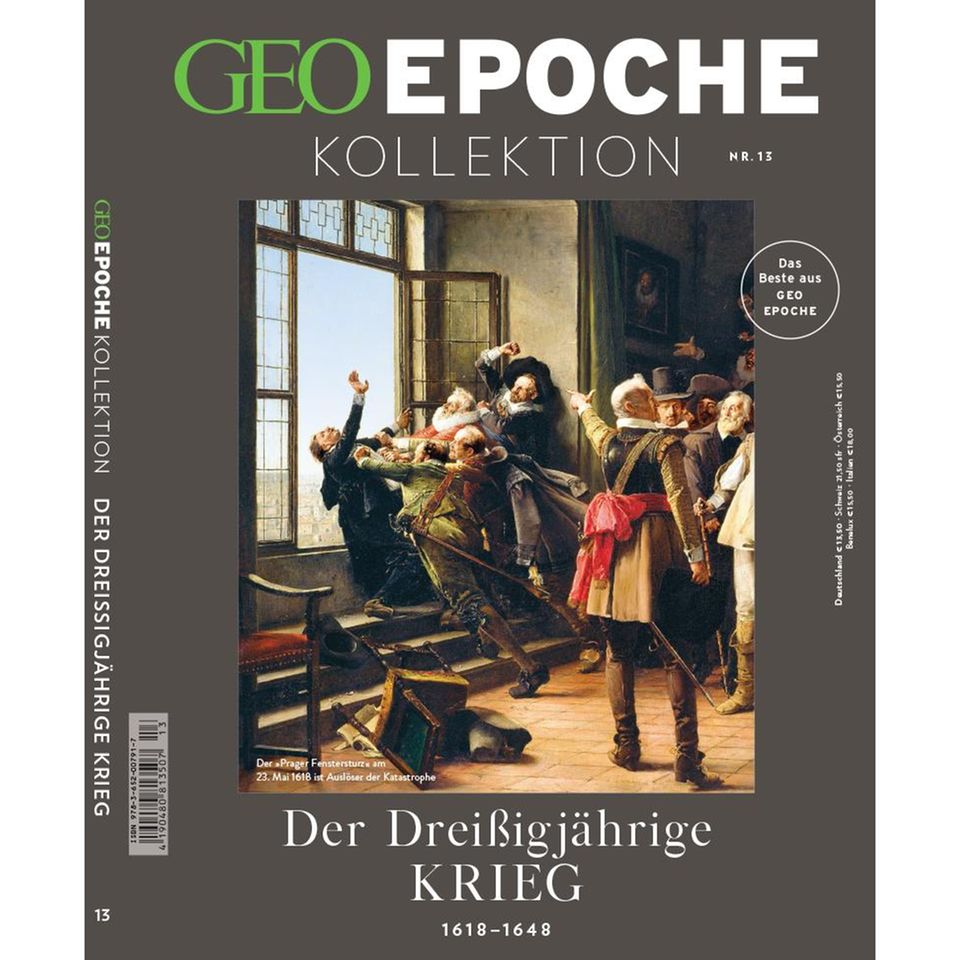Am 20. Mai 1631 stürmen mehr als 20 000 kaiserlich-katholische Soldaten Magdeburg. Nach einem halben Jahr Belagerung überlässt Feldherr Johann T'Serclaes Graf von Tilly seinen Söldnern die Hochburg der Protestanten nun zur Plünderung. Soldaten schänden Frauen und Mädchen und töten all jene, die Gegenwehr leisten. Bald lodern überall in der Stadt Feuer, säumen Tote die Straßen. Nur etwa ein Drittel der 30 000 Einwohner überlebt. Es ist das gnadenloseste Massaker des Krieges.
Bereits wenige Tage später wird die Nachricht auf Flugblättern und in mehrseitigen Flugschriften veröffentlicht, dann auch in Wochenzeitungen. Anhänger der Protestanten ziehen Vergleiche zur Zerstörung Jerusalems. Dagegen verbreiten die in Köln erscheinenden „Reichs-Zeitungen“ das Gerücht, die Magdeburger hätten die Stadt selbst in Brand gesteckt. Die Parteien bekämpfen sich mit allen Mitteln, auch mit Propagandaschriften. Und die Sensationslust der Menschen, ihre Gier nach Neuigkeiten, garantiert den Verlegern dieser Werke gute Absätze.
Durch Gutenberg können Texte massenhaft verbreitet werden
Seit Johannes Gutenberg um 1450 den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern erfunden hat, zirkulieren unüberschaubar viele Druckwerke im Reich. Texte, die Gelehrte zuvor mühsam von Hand kopiert haben, können nun massenhaft verbreitet werden. Drucker stillen den Hunger auf Informationen und bringen sie als Verleger selbst unter das Volk. Anfangs mit Flugblättern und Flugschriften, in denen sie politische und religiöse Neuigkeiten verbreiten.
Zwei bis vier Kreuzer kostet ein Flugblatt zu Beginn des 17. Jahrhunderts, das entspricht dem Stundenlohn eines Maurers. Fahrende Händler verkaufen die Blätter auf ihren Reisen. In Frankfurt und Leipzig erscheinen während der dortigen Buchmessen bis zu 100 Seiten starke Schriften mit Berichten vom Geschehen während der vergangenen Monate.
„Relation“ und „Aviso“ die ersten Zeitungen der Welt
Schreiber lassen sich in den Städten als Korrespondenten nieder, tauschen Texte und Informationen aus. Ihre Meldungen verschicken sie in der Regel über die Kaiserliche Reichspost; die Generalpostmeister überziehen das Reichsgebiet mit einem immer dichteren Netz von Pferde- und Botenstationen. Die Post garantiert den Verlegern einen nie versiegenden Strom von Nachrichten. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts können die Publizisten erstmals sicher sein, halbwegs aktuell und regelmäßig berichten zu können. Und so erscheinen 1605 in Straßburg und 1609 in Wolfenbüttel mit der „Relation“ und der „Aviso“ allwöchentlich die ersten Zeitungen der Welt.
Zumeist drucken die Blätter Sammelkorrespondenzen ab, die Schreiber aus dem gesamten Reichsgebiet anhand verschiedener Quellen zusammengestellt und den Zeitungsverlegern verkauft haben. Die präzise Herkunft der einzelnen Informationen geht dabei zwar häufig verloren, ihr Wahrheitsgehalt lässt sich also nur schwer überprüfen.
Geschäft mit Nachrichten verspricht beste Umsätze
Die Druckhäuser vertreiben die Zeitungen an Abonnenten, Schankwirte ordern die Periodika und lassen ihren Kunden daraus vorlesen. So erreichen Auflagen von 350 Exemplaren die zehnfache Zahl an Lesern. In vielen Städten konkurrieren bald mehrere Verleger um die wissenshungrige Kundschaft.
Flugblätter erscheinen dagegen zumeist anonym – denn es gibt genügend Missstände, die sich gewinnbringend anprangern lassen. Allein über die Geldfälscher, die sich seit 1620 verstärkt am Austausch guter gegen minderwertige Münzen bereichern, werden binnen weniger Jahre rund 100 Flugschriften mit einer Gesamtauflage von 125 000 Exemplaren unter das Volk gebracht. Nach dem Inferno von Magdeburg beschreiben Publizisten den Krieg mehr denn je als einen Konflikt der Konfessionen. Mit jeder weiteren Sensationsnachricht stehen sich die gegnerischen Seiten unversöhnlich gegenüber. Das Geschäft mit den Nachrichten verspricht beste Umsätze.
Als der Krieg 1648 endet, gibt es im Reichsgebiet bereits gut 50 Zeitungen. Manche erscheinen mehrmals pro Woche, eine sogar schon täglich. Als Vermittler von Information und Meinung sind sie fortan unverzichtbar.