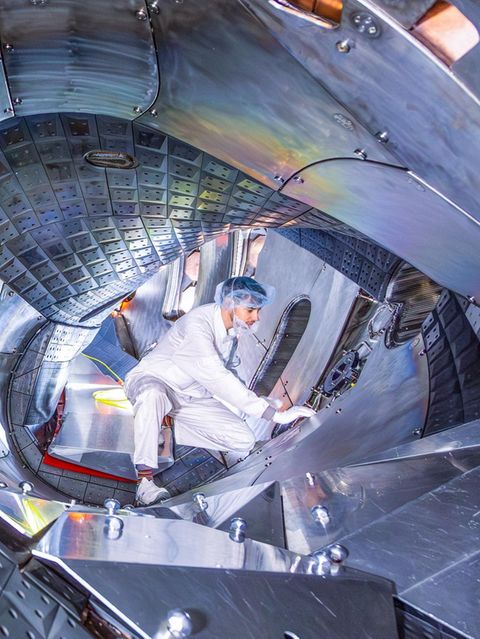In der Gruppe durch den Schnee
Genau darum bin ich hier. Im Winter in die Schweizer Alpen? Da denken viele an schwarze Pisten, an Carving in tiefer Hocke und Fahrtwind im Skidress. Dazu muss man wissen: Dies ist mein erster Winterurlaub in den Bergen. Ich will mich langsam und leise an das Thema herantasten. Ich werde also nicht Ski fahren und nicht snowboarden, ich werde wandern.
In der Gruppe durch den Schnee stapfen
Dafür bin ich in den östlichsten Teil Graubündens gereist, wo die Grenzen zu Österreich und Italien nicht weit entfernt sind. Abmarsch ist in Ardez. Um halb zehn Uhr morgens, als wir losziehen, sitzen im Gastraum unseres Hotels bereits einige Handwerker beim zweiten Frühstück. Das zeigt: Wandern im Winter, dafür muss man nicht in aller Herrgottsfrüh aus dem Bett. Weil Gesellschaft manchmal gut tut, wandere ich in einer Gruppe. Sechs Leute, die alle ruhig durch den Schnee stapfen wollen. Plus Hilde. Hilde ist ungefähr 70, ungefähr doppelt so fit wie ich und sehr kommunikativ. Wir sind noch nicht einmal die paar Stufen vom Hotel auf die Straße gegangen, da hat sie schon erzählt, welche Gletscher sie in den letzten Wochen auf Skiern hinuntergebrettert ist. Hilde hat härteste, wochenlange Höhenwanderungen mit Expeditionsgepäck durchgestanden. Hier aber brauchen wir höchstens einen Tagesrucksack, denn unser Gepäck wird von Hotel zu Hotel gefahren.
"Super, dann bist du ja richtig fit!", sagt Hermann, und Hilde strahlt. Hermann ist unser Bergführer, ein echter Engadiner. Eigentlich ist er längst pensioniert, doch nun, sagt er in seinem langsamen Bündner Singsang, könne er machen, wozu er Lust habe. Man kann sich nicht vorstellen, dass Hermann jemals seine Ruhe verliert. Zum Warmwerden fahren wir mit dem Zug bis Susch. Das könnte man an einem Vormittag auch bequem zu Fuß schaffen. Aber bei dieser Reise geht es gar nicht um das, was man alles schaffen könnte. Außerdem sind die roten Schmalspurzüge der Rhätischen Bahn ein Knüller. Offensichtlich sind sie fast fabrikneu, aber sie sehen aus wie aus dem vorletzten Jahrhundert. Was auch an der Kulisse liegt: In diesem Teil der Schweiz gewinnen die Dörfer regelmäßig Preise für traditionsbewusstes Bauen.
Außer uns ist kein Mensch auf der Straße
Unser erstes Ziel, Susch, ist so ein Dorf. Extrem fotogen. Viele Hauswände sind mit bunten Bildern geschmückt, mit sgraffiti, die in verschiedenfarbige Putzschichten gekratzt wurden. Gäbe es den pittoresken Putz nicht, könnte ein Dorf wie Susch mit seinen original Engadiner Bauernhäusern schnell abweisend wirken: wuchtige Mauern aus Bruchstein, wenige, winzige und tief eingelassene Fenster; unten Stall, oben Wohnräume und Heuboden. Was von außen wie ein Wehrgehöft aussieht, muss drinnen sagenhaft kuschelig sein. Außer uns ist kein Mensch auf der Straße, und uns bläst ein kalter Wind um die Pudelmützen. Dafür präsentiert uns Hermann in der Ortsmitte einen Clou. "Könnt ihr bitte mal zusammenkommen!", sagt er vor einer Brücke. Er sagt es so schweizerisch ruhig und nachdrücklich, dass alle spüren, jetzt kommt ein großer Moment. "Dieses Dorf Susch", sagt Hermann, und er macht eine sehr lange Pause, "ist das einzige Dorf, das einzige Dorf im Unterengadin, durch das der Inn mitten hindurch fließt." Wir wissen alle nicht, was wir sagen sollen. Und so marschieren wir endlich los, talabwärts auf der südlichen Flussseite.
Zum Hören
Wir haben auf Slowmotion geschaltet: Beim Winterwandern im Unterengadin geht es nicht um Streckenrekorde und Höhenmeter. Sondern um den Rhythmus des eigenen Herzschlags und die Kunst der Langsamkeit. Hören Sie die Reportage "So weiß die Füße tragen" aus GEO Saison 12/2008. Es liest Bertram Weiß (Länge: 11:59 Min.; 10,9 MB)
Fast könnte man glauben, das Tal steht schief
Auf Rätoromanisch heißt der Inn "En", und daher hat das Tal seinen Namen. Oben ist das Engadin weit und offen mit vielen Seen; hier unten rücken die Hänge enger zusammen, und der Fluss windet sich wilder hindurch.
Trotzdem ist Platz für zwei Mikroklimata: An den Südhängen ist es trockener, darum überwiegen Lärchenwälder, während an den Nordhängen Tannen und Kiefern wachsen. Wenn man erst auf die eine Seite schaut, dann schnell auf die andere, könnte man glauben, das Tal stehe schief. Das liegt daran, dass die Bäume bis in unterschiedliche Höhen wachsen, rechts bis gut 2000, links bis 1800 Meter. Hermann, unser Guide, kennt jeden Baum und jeden Stein, jeden Bauern und jede Kuh im Unterengadin und strahlt die ruhige Gewissheit aus, dass er hier am absolut richtigen Ort ist. Ganz gemächlich geht es an diesem ersten Tag fast ohne Steigungen dicht am Fluss entlang durch den Wald und über Wiesen. Für eine erholsame Winterwanderung ist dies wahrscheinlich die perfekte Landschaft. Und weniger Niederschlag als hier fällt kaum irgendwo in der Schweiz.
Es liegt genügend Schnee, um die Wege hübsch winterlich zu machen, aber nicht so viel, dass das Gehen mühsam wäre; genug, um die Schritte zu dämpfen, aber nicht so viel, dass sich unter den Sohlen dicke Klumpen bilden würden; genug, aber nicht zu viel, um schon nach kurzer Zeit zu gehen und zu schauen und nur noch ganz wenig zu denken. Hermann wandert abwechselnd neben jedem von uns und lauscht, wer reden will und wer nicht. So groß und schwer er ist und so behäbig er im Sitzen wirkt, so stetig und leicht bewegt er sich draußen. Hilde klemmt sich neben mich und will über ihre letzte Schneeschuhtour in Kanada sprechen. Doch ein Wanderkamerad kommt ihr zuvor: "Wenn du schnell ans Ziel kommen willst", predigt er, "musst du langsam gehen. So sagen die Tibeter." Hilde schaut ratlos. Wenn es nicht um Leistung geht, wo soll sie andocken? Wenig später sind wir zurück im Hotel.
Der Weg folgt früheren Handelsrouten
Auch am nächsten Tag wird die Tour kein physischer Grenzgang. Wir ziehen auf der nördlichen Talseite entlang Richtung Osten. Unser Wanderweg, die Via Engiadina, mäandert durchs Tal und folgt dabei alten Handelsrouten, die früher die Siedlungen verbunden haben. So gehen wir von Dorf zu Dorf, von Ardez über Ftan nach Scuol. Meistens benutzen wir Feldwege, auf denen gerade die richtige Menge Schnee liegt, um beim Gehen so zu knirschen, dass man sich keine passendere Musik vorstellen kann. Dieses Knirschen des Schnees auf diesen Unterengadiner Wanderwegen ist ein Zen-Geräusch. Es erinnert mich mit seinem gleichmäßigen Takt daran, mich über das Gehen und den Moment zu freuen.
So kommt mir bis zu den Ruinen von Gonda jede Hektik abhanden. Eine Weile stehe ich vor den Resten der Siedlung. Ich wohne am Meer, wie alle meine Vorfahren, da kommt mir das
Leben in den Bergen ungewohnt und hart vor. An diesem Fleck scheint es besonders unwirtlich gewesen zu sein. Der Hang über uns sieht nicht freundlich aus. Die Bäume verrenken sich noch absurder als die windschiefen Knicks in Schleswig-Holstein. Immer wieder haben diese Bäume von Lawinen eine Ladung aufs Dach bekommen. So stehen sie gebeugt, aber sie stehen. Die Häuser jedoch waren nicht so biegsam und stürzten ein, und die Menschen hatten irgendwann im 17. Jahrhundert die Nase voll von der Angst und der Enge und zogen fort.
Von Gärungsprozessen und Reifegraden
In Ftan besuchen wir eine Käserei. Ein Milchbauer und der Käsermeister erzählen bemüht sachlich und dabei hoffnungslos zärtlich von den Kräutern auf den Almen und von Gärungsprozessen und Reifegraden. So viel höre ich noch heraus, sonst verstehe ich kein Wort, selbst wenn die Männer das sprechen, was sie für Hochdeutsch halten. Dafür sprechen sie in einer grandiosen Melodie, die hervorragend zum Rhythmus unserer Wanderung passt. Noch schöner wird es, wenn die Einheimischen untereinander Rätoromanisch sprechen. Es klingt nach schwerem Italienisch. Nicht gerade nach tanzenden Neapolitanern, eher nach engen Tälern und schweren Wolken, nach langen Blicken in den Wetterhimmel und bedächtigen Worten über die letzte Ernte.
Diese Sprache heute noch zu hören ist gar nicht so einfach. Die Einheimischen stehen im Winter ja nicht einfach auf der Straße herum und warten auf Touristen. Also gehen wir unterwegs in jede Kneipe und jedes Café, die geöffnet haben. In einem Dorfladen kaufe ich Schweizer Schokolade. Dann sitze ich mit einem Biera Engiadinaisa auf einer Terrasse und lutsche eine Tafel Ovomaltine dazu; ich schaue hinaus auf die mächtigen, zerfurchten Gipfel der Engadiner Dolomiten und lausche, wie Hermann leise mit der Wirtin redet, und das hört und fühlt sich so unsagbar entspannt an, das reicht locker für mich und ein bisschen sogar für Hilde mit, die jetzt manchmal minutenlang nicht spricht. Wieder unterwegs, hocke ich eine Viertelstunde vor einem Bach und sehe zu, wie das Wasser einen Eiszapfen umformt. Ich lasse meine Mitwanderer weit voraus gehen, bis ich nicht einmal mehr ihr Stapfen im Schnee höre.
Heidi-Kulisse im Schnee
Am dritten Tag wandern wir zum Dorf Sent. Das liegt weit unten im Tal, sehr gedrängt, kein einziges modernes Haus ragt heraus. Weithin ist der Kirchturm zu sehen, dahinter erhebt sich eine Felswand, und auf den Almen ringsherum wird es im Frühsommer so dermaßen blühen, dass nicht einmal das dauernd miesepetrige Fräulein Rottenmeyer schlechte Laune behalten könnte. Tatsächlich wurde hier vor ein paar Jahren ein neuer Heidi-Film gedreht. Nicht weit entfernt liegt auch das wichtigste Skigebiet des Unterengadin. Auf unserem Weg müssen wir einmal quer über die Pisten. Plötzlich wimmelt es von Menschen. Sie fahren mit Skiern und Snowboards und Schlitten auf mich zu, sie jauchzen laut, sie tragen bunte Klamotten, verspiegelte Brillen und witzige Verzierungen an ihren Helmen. Ihre Gesichtszüge sind angespannt, solange sie fahren. Unten sind sie immer noch angespannt, weil sie ganz laut "Geiler Ride!" brüllen müssen. Wir gehen schnell ein Stück weiter in den Wald hinein. Auf einer Bank, hoch über dem Schnee, teilen wir unsere letzten Vorräte. Schauen kauend hinüber in den Nationalpark. Ein großer Raubvogel kreist. Jemand seufzt. War ich das?