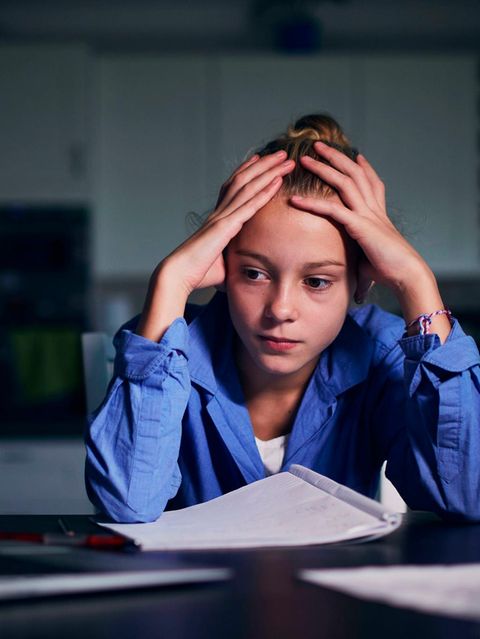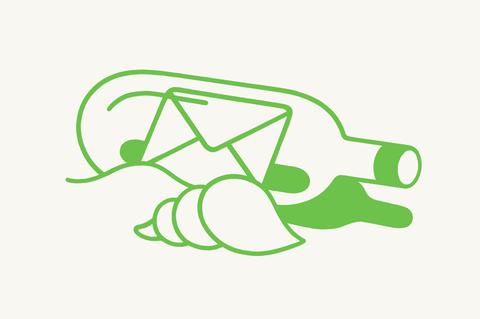Warum ich hier bin
Die kleine Gemeinschaft der Menschen, die in der unwirtlichen Bergregion Nordafghanistans ausharren, ist das Relikt einer leidvollen Geschichte. Vor 150 Jahren lebte dieses Hirtenvolk nur im Sommer in den afghanischen Pamir-Hochtälern, einer durch Gletscherbewegungen geformten Einöde zwischen Hindukusch und Pamirgebirge. Im Winter, wenn die Temperatur dort bis unter minus 50 Grad Celsius sinken kann, trieben die Pamir-Kirgisen ihre Schafherden hinab in die tiefer gelegenen Täler auf dem Gebiet des heutigen Tadschikistan.
Doch dann schnürten geopolitische Entwicklungen die Nomaden in ihrem Winterquartier ein: Die Pamirtäler liegen seit 1895 im sogenannten Wakhan- Korridor, einem 270 Kilometer langen, stellenweise nur 15 Kilometer breiten Landstreifen, der im russisch-britischen Pamir-Vertrag damals Afghanistan zugeschlagen wurde, um das britisch beherrschte Indien vom russischen Zarenreich zu trennen.
© Matthieu and Mareile Paley / www.paleyphoto.com
Noch vor der Invasion Afghanistans durch Sowjettruppen 1979 floh der damalige Khan mit seinen 1300 Untertanen aus dieser Enklave ins benachbarte Pakistan. Der größte Teil der Gruppe übersiedelte vier Jahre später in die Türkei, wo die Exil-Kirgisen aus dem Pamir inzwischen in Dörfern mit Kanalisation, Straßenanbindung und Elektrizität leben und ihre Kinder in Schulen und Universitäten schicken.

Eingeschlossen von mächtigen Nachbarn
Das beeinträchtigte die Kirgisen im Pamir zunächst kaum - jedenfalls solange die Staatsgrenzen nur auf dem Papier bestanden. Doch nach 1930 schloss die Sowjetunion die Grenze nach Norden. Auf der Ostseite des Korridors schottete sich das 1949 kommunistisch gewordene China ab. Und im Süden verwehrten bald die Grenzposten Pakistans den Hirten den Übertritt. Die Kirgisen fanden sich als Bewohner eines entlegenen Zipfels Afghanistans wieder, beschränkt auf zwei 100 und 60 Kilometer lange Hochtäler, eingeschlossen von drei Staatsgrenzen und 5500 Meter hohen Bergmassiven.
Leben in einer Zeitblase
Nur etwa 250 Kirgisen unter der Führung des verstorbenen Khan Abdul Raschid haben sich 1979 entschlossen, zurück ins afghanische Bergland zu ziehen, um dort ihr altes Leben wieder aufzunehmen: ein Leben in einer Zeitblase, fernab jeder Zivilisation, acht Tagesritte entfernt von der nächsten Ambulanzstation. Und vier Tagesritte von der nächsten Schule. 30 Jahre lang hat kaum ein westlicher Anthropologe nachgeforscht, wie es dieser Gruppe seither ergangen ist. Das will ich nachholen, denn es gibt viele ungeklärte Fragen: Wie organisieren die Pamir-Kirgisen ihr Zusammenleben in dieser lebensfeindlichen Umgebung?
Wodurch erhält der Khan, ihr Anführer, seine Autorität? Wie vertritt er die Interessen seiner Untertanen? Nach welchen Regeln funktioniert die kleine Ökonomie der Pamir-Kirgisen? Und wie haben sich ihre Traditionen inzwischen verändert? In Bischkek, der Hauptstadt des nicht an Afghanistan grenzenden Landes Kirgisistan, in dem mit 5,2 Millionen Kirgisen heute die große Mehrheit dieses Turkvolkes zu Hause ist, habe ich deshalb die Sprache gelernt. So konnte ich meinen Aufenthalt in den 700 Kilometer entfernten Bergen vorbereiten.
Mein Alltag
Ich liege in meinem Schlafsack, starre auf den Raureif am Zeltdach - das ist mein Atem, der sich im Laufe der Nacht dort niedergeschlagen hat. Ich bin aufgewacht, weil ich vor Kälte schlottere: Die Wintermorgen im Pamir sind erbärmlich. Die Zahnpasta ist gefroren, auch die Erdnussbutter, auch das Wasser, das ich am Tag zuvor geholt habe. Ich gehe nach nebenan in mein "Büro-Zelt", das zugleich meine Küche ist, und schmelze Eis für den Kaffee.
Der Winter beginnt hier, auf einer Höhe von über 4000 Metern, im frühen September. Dann wird es nach und nach ungeheuerlich kalt. Zwar kann die Nachttemperatur selbst in den Sommermonaten unter Null Grad fallen, und schneien kann es fast immer. Ab Oktober aber schmilzt der Schnee nicht mehr. Und Bad-i Wakhan, ein Wind aus Südwest, bläst unentwegt; die lange Zeit der Schneestürme beginnt. Die Teilnehmer einer französischen Expedition kamen 1886/87 zu dem Schluss, dass man "schon ein großes Verbrechen begangen haben muss, um im Pamir bleiben zu wollen ..."
Karge Mahlzeiten
In dem Wintercamp, in dem ich mich befinde, leben sieben Familien. Anfangs aß ich meist gemeinsam mit ihnen in ihren Jurten; die Mahlzeiten bestanden aus Brot, Joghurt, Sahne, einer Art Mozzarella, getrocknetem Quark, Tee mit Milch und Salz sowie Reis, der mit viel Pflanzenöl zubereitet wird. Bald allerdings hatte ich genug von dieser Kost. Und ich wollte die Vorräte der Kirgisen nicht beanspruchen.
Also begann ich, eigene Mahlzeiten zu kochen. Sie schmeckt furchtbar, diese Mischung aus Haferbrei, Nudeln, Dosenthunfisch und Keksen, und so habe ich innerhalb von vier Monaten etwa zehn Kilo abgenommen. Das merkte ich auch daran, dass ich die Frauen bitten musste, mir die Gummibänder an meinen Unterhosen enger zu nähen. Was sie natürlich kommentierten: „Wie dürr du geworden bist! Weil du nicht mit uns essen willst!“ Anfangs gab ich den Frauen auch meine Wäsche; aber weil sie trockenen Dung benutzen, um das Wasser zu erhitzen, stanken alle meine Kleider nach Yak.
Deshalb wasche ich meine Wäsche jetzt selbst. Was eine Quälerei ist: Ich muss mindestens zweimal zum Wasserholen gehen, was viermal 20 Minuten dauert. Dann warte ich eine Stunde, bis das Wasser auf meinem Gaskocher heiß geworden ist. Danach fülle ich mehrere Eimer und verbringe eine weitere Stunde damit, die Wäsche einzuweichen, zu schrubben, zu spülen. Schließlich hänge ich die Kleider auf, lasse sie einfrieren, schlage sie gegen einen Stein, um das Eis abzulösen und bringe sie dann ins Zelt. Dort hänge ich sie für mehrere Tage auf, bis sie endlich trocken sind.
Die Gesetze der Hirten-Ökonomie
Yaks und Schafe sind das Herzstück der Wirtschaft im Pamir. Dem Vieh gilt die gesamte Sorge der Kirgisen, und das Ziel eines jeden Mannes ist es, den Nachsatz "bai" im Namen zu tragen: Ein "reicher Mann" ist derjenige, der mehr als 100 Schafe, 30 Yaks und einige Pferde besitzt. Und vielleicht sogar Kamele; die steigern das Prestige.
Die Kirgisen passen den Lauf ihres Alltags den Bedürfnissen der Tiere an: Diese diktieren, wann morgens aufgestanden und wann gegessen wird, und wann es Zeit ist, in ein neues Lager zu wechseln. Die Abläufe sind seit Jahrhunderten dieselben, auch wenn sich die Zahl der Tiere stark verringert hat. Gegenwärtig gibt es im Pamir wohl rund 10 000 Schafe und Ziegen. In den 1970er Jahren waren es noch viermal so viele, fast die Hälfte davon im Besitz der Familie des damaligen Khan.
Zehn Jahre Brautdienst
Ich bin unterwegs mit Osmon, einem Hirten. Auch Osmons Vater ist opiumsüchtig und besitzt deswegen kaum eigenes Vieh. Was bedeutet, dass er die 100 Schafe, den Brautpreis unter reichen Familien, nicht bezahlen kann. Also ist Osmon gezwungen, seinen „Kuch Keyaw“ abzudienen, seinen Brautdienst, indem er zehn Jahre im Lager seines künftigen Schwiegervaters arbeitet.
Wohin Osmon die Herde treibt, hängt von der Schneemenge ab. In trockenen Wintern sind die Weiden offen, und Pferde, Yaks, Schafe, Ziegen, Kamele und Esel können überall grasen. Sonst aber muss das bisschen, das die Tiere unter der Schneedecke finden, mit Trockenfutter ergänzt werden - mit Gras, das am Ende des kurzen Sommers geschnitten und in großen Steingehegen gelagert wird. Die Futtervorräte im Pamir sind jedoch beschränkt, in jedem schneereichen Winter verhungern Tiere. Andere sind an dessen Ende so geschwächt, dass sie im März und April sterben, wenn die ersten Lämmer zur Welt kommen. Gewinnen können die Pamir-Kirgisen in diesem Kreislauf nicht: Wenn zu viel Schnee fällt, stirbt auch viel Vieh, aber im Jahr darauf wird immerhin ausreichend Weideland zur Verfügung stehen. Fällt aber wenig Schnee, dann überlebt zwar das Vieh; dafür werden die Futtervorräte im Folgejahr knapp.
Das schlimmste Szenario heißt „Jüt“, es tritt im Frühling ein, wenn Neuschnee die Weiden bedeckt und nach einigen warmen Tagen, an denen dieser Schnee schmilzt, eine Kaltfront das Land plötzlich einfriert. Die Tiere können sich nicht durch das Eis graben - und Heu gibt es kaum noch. Dann geht oft über die Hälfte einer Herde ein. Und da das Gesetz des Islam Tiere, die eines natürlichen Todes gestorben sind, als „haram“, unrein, bezeichnet, bedeutet dies, dass sie nicht gegessen werden dürfen. Die Kadaver werden den Hunden überlassen. Auch sie gelten nach muslimischer Lehre als unrein - wie nützlich sie auch sein mögen.
Zwischen Verwunderung und Dankbarkeit
Als ich meine ethnologische Arbeit im Pamir begann, habe ich mir ein ganz bescheidenes Ziel gesetzt: Ich werde beobachten, aufzeichnen, was ich sehe - und werde den Kirgisen gegenüber meine Meinung für mich behalten. Ich will vermeiden, als "Amerikalyk" aufzutreten, der sie mit irgendwelchen Kommentaren zu ihrem Tun belästigt. Dies entspricht auch einem zentralen Glaubenssatz meines Faches, der "Kultur- Relativismus" verlangt: Benutze nie deine eigene Kultur als Vergleich und Maßstab zur Bewertung anderer Kulturen! Das ist schön gedacht - nur leider nicht zu machen.
Denn natürlich bin ich dauernd in der Verlegenheit, zu beurteilen, was ich sehe. Ich frage mich zum Beispiel manchmal, was ich bei allen Vorbehalten an den Kirgisen bewundere: Zuallererst ist das ihr Durchhaltewille - sie überleben ("gedeihen" wäre zu viel gesagt) an einem Ort, der für ein zivilisiertes Auskommen zu unwirtlich ist. Sie hätten ihre harte Existenz aufgeben können. Kirgisistan hat 1999 das Angebot gemacht, die restlichen Pamir-Kirgisen aufzunehmen. Niemand hat sie gezwungen, im Pamir zu bleiben. Sie haben sich selbst dafür entschieden, trotz der Kälte, trotz des Mangels an Straßen und Schulen. Was mich zur anderen Seite der Medaille bringt: Ich finde, sie sollten für diese Entscheidung die Verantwortung übernehmen. Stattdessen fühlen sie sich als Opfer, verhalten sich wie Kettenraucher, die wegen ihrer Sucht die Tabakfirmen verklagen.
Eine verheerende Bilanz
Abdul Raschid Khan war 30 Jahre im Amt, und unter seiner Führung wurde keine einzige Schule, Straße oder Gesundheitsstation gebaut; die Schuld dafür sehen er und sein Volk bei jenen, die ihnen all das, angeblich, verweigern. Bei der afghanischen Regierung zum Beispiel, die allerdings tatsächlich nicht besonders freigebig ist. Oder bei der Aga-Khan-Stiftung, die im Gebiet des benachbarten Wakhan-Stammes den Straßenbau fördert, nicht aber in den Pamir-Hochtälern.
Dass die Wakhan bereit sind, für einen Lohn von drei Dollar pro Tag auf der Baustelle zu helfen, das können die Pamir- Kirgisen nicht verstehen: Wer bei klarem Verstand sei, so wird mir erklärt, müsse für solche Arbeit 30 Dollar verlangen. Ihre freie Zeit verbringen die Kirgisen daher lieber mit Teetrinken. Und das bisschen Geld, das sie durch den Verkauf von Schafen erwirtschaften, stecken sie lieber in Fernsehapparate und Opium statt in Bücher und Arzneimittel.
Begründete Vorurteile
In der Außenwelt ist das Ansehen der Pamir-Kirgisen entsprechend schlecht. Und ich kann diese Vorurteile leider nicht widerlegen. Auch ich wurde während meines Aufenthalts belogen, übers Ohr gehauen, bestohlen, und bisweilen schien es mir, als würde ich meine Zeit statt mit neutraler Beobachtung mit kleinlichen Streitigkeiten verbringen.
Aber ein britischer Arzt mit vier Jahren Arbeitserfahrung vor Ort gab mir recht: „Die Menschen, bei denen du lebst, sind angenehm, und das ist einzigartig unter den Kirgisen.“
Eines Tages sagte mir mein Freund Roshan, der spürte, dass ich deprimiert war: "Schau dich um! Wer außer dir kann schon jedes Haus hier betreten, selbst wenn kein Mann da ist? Du kannst dich zu den Frauen setzen und Tee trinken. Wann immer du willst, kannst du zum Khan gehen, oder zu seiner Frau, und mit ihnen reden. Unsere Frauen dürfen zu dir ins Zelt kommen, weil wir wissen, dass sie bei dir sicher sind. Meine Tochter besucht dich jeden Tag, und ich mache mir nie Sorgen, weil ich und alle anderen hier dir vertrauen." Und ein anderer sagte: "Du kehrst nach Amerika zurück, aber du wirst immer ein Teil unserer Familie sein. Du bist jetzt Shai’ym. Deine Heimat ist in Amerika, aber sie ist auch hier." Shai’ym bedeutet: eine angesehene Abstammung. Ich kämpfte mit den Tränen und murmelte ein Dankeschön. Es kam mir äußerst unzureichend vor.