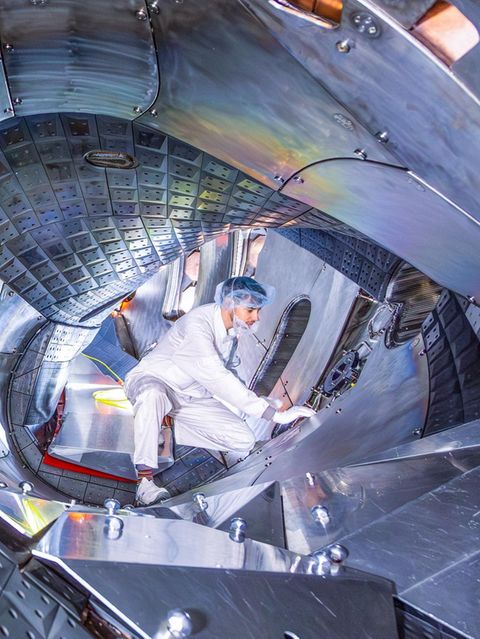Seit 30 Jahren reisen Sie immer wieder in die Wüsten der Welt. Auf was freuen Sie sich jedes Mal bevor Sie wieder aufbrechen?
Auf diese totale Gegenwelt zu unserem Leben, das bei uns in Europa so kompliziert geworden ist. In der Wüste hingegen ist alles viel leichter, weil das Leben auf die Grundbedürfnisse reduziert ist. Man muss schauen, dass man Wasser findet und die richtige Richtung. Leben und Reisen sind hier viel einfacher.
Wie hat sich Ihre enge Verbindung zur Wüste überhaupt entwickelt?
Als Jugendlicher hat mich Astronomie interessiert und damals wollte ich unbedingt mal den Südsternhimmel sehen. Als 17jähriger bin ich dann mit dem Moped nach Marokko gefahren und habe zum ersten Mal die Wüste erlebt. Danach hatte es mich gepackt.
Nach so vielen Jahren in diesen unwirtlichen Regionen hat man so etwas wie eine Lieblingswüste?
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist das die Königin aller Wüsten: die Sahara. Die ist einfach einzigartig auf der Erde. 25 Mal so groß wie Deutschland und sie bietet an Wüstenlandschaften alles, was es so gibt. Auch in ihren absoluten Extremen. Nach der Sahara kommt erst mal lange nichts - in jeglicher Hinsicht. Dann kommen Wüsten wie die Gobi, Namib und Atacama.
Wie muss man sich so eine Reise von Ihnen vorstellen: Sie streifen mit Ihrer Fotoausrüstung tagelang durch das Gelände, übernachten im Zelt und tauchen nach Wochen wieder in der Zivilisation auf?
Ja, so in der Art kann man sich das vorstellen. Ich tauche nach einigen Tagen etwa in einer Oase im Tschad auf, da besteht die Zivilisation aus einem Benzinfass und einem Stand, an dem man Tomatenmark und Nudeln kaufen kann. Das ist dann mein Ausgangspunkt für die nächste Wüstenetappe, auf der mein Motorrad zur rollenden Oase wird. Da ist alles drauf, was ich zum Überleben brauche: Kamera, Wasser, Benzin, Campingausrüstung. Je nach Strecke, je nach Wüste muss ich nach zwei bis acht Tagen wieder andocken, um die Vorräte wieder aufzustocken. Ich übernachte übrigens nicht im Zelt, sondern mit Isomatte und Schlafsack unter freiem Himmel.
Streifen Sie allein durch die Wüste – oder in Begleitung?
Ich bin mit vielen Freunden unterwegs gewesen oder mit der Partnerin, mit der ich zu der Zeit zusammen war. Selten mit mehr als zwei Menschen. Sind es mehr Personen, diskutiert man dann abends mehr über Dinge wie die Finanzmarktproblematik, als sich über die Wüste zu freuen.
Früher sind Sie mit Geländewagen durch die Wüste gedüst, seit einigen Jahren nur noch mit Motorrad. Warum?
Damit ist man einfach flexibler. Notfalls lässt es sich auch mal auf einen LKW laden. Oder man schiebt es in eine Hütte und lässt es für einige Tage stehen. Auch der Transport ist weitaus günstiger. Und: Die Wüstenbewohner reagieren viel positiver darauf. Die sind alle total fasziniert von dem Gefährt - und schauen etwa bei Grenzkontrollen nicht so genau hin. Das kommt mir zugute, denn ich habe jede Menge Fotoausrüstung dabei. Und in einigen Ländern gibt es großes Misstrauen gegen Journalisten. Da ist es gut nicht aufzufallen.
Können Sie sich erklären, woher das große Interesse für das Motorrad kommt?
So große Maschinen sind in vielen Ländern vollkommen unbekannt. Dort kennt man nur Mopeds. Dagegen wirkt mein Motorrad wie ein Raumschiff. Man hört die Leute murmeln "240 Stundenkilometer" – oder hört Fragen wie "How many cc?", wie viel Hubraum oder auch "How much?". Die Interessenslagen der Männer waren doch sehr eindeutig gelagert.
Sind Sie auf all Ihren Reisen jemals an Ihre Grenzen gestoßen?
Es gibt eine physische Grenze, eine mentale und eine lebensgefährliche. Physisch bin ich immer wieder an meine Grenze gestoßen. Das hat sehr viel mit Hitze zu tun – und mit dem Motorrad. Das Fahren im Sand ist viel anstrengender als mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich lag schon oft auf der Nase, musste mich wieder aufrappeln. Da kommt man schnell an seine körperlichen Grenzen. Mental machen mir Sicherheitsprobleme zu schaffen, wenn man etwa in Ländern wie Mali, Mauretanien, Tschad, Iran und Afghanistan unterwegs ist. Die Gefahren dort sind nicht offensichtlich, aber man spürt sie die ganze Zeit. Man weiß beispielsweise, dass die Strecke vermint ist und hofft, dass die Markierungen stimmen. Oder man weiß, dass Banditen in der Gegend sind und hofft, dass die auf Motorräder nicht so scharf sind. Wüstenreisen sind kein Zuckerschlecken. Es ist eine Kombination aus Schwierigkeitsgrad der Strecke, Güte der Ausrüstung, Erfahrung und Wetter. Wenn ungünstige Verhältnisse zusammenkommen, ist das schon dramatisch.

Michael Martin - 30 Jahre Abenteuer
288 Seiten, ca. 220 Fotografien
ISBN 978-3-89405-702-2
In Lebensgefahr sind Sie aber nicht geraten?
Ich bin in Tschad mal von Rebellen drei Stunden lang umstellt worden mit Maschinengewehren im Anschlag, bis sie uns frei ließen. Und ich bin haarscharf an der Entführung 2003 in der Sahara vorbeigeschlittert, bei der 16 Motorradfahrer verschwunden waren. Ich wollte die gleiche Strecke fahren, hatte mich aber an einer Tankstelle erkundigt, ob alles okay sei auf der Strecke. Der Tankwart hat mich gewarnt - zum Glück.
Trotz all der Gefahren kann man sie aber scheinbar trotzdem nicht von Ihren Wüstenreisen abhalten, oder?
Ich denke mal, wenn man sich zu Hause gut informiert, wo welche Gefahren lauern, etwa beim Auswärtigen Amt, kann nicht viel passieren. Und vor Ort muss man natürlich Augen und Ohren offen halten. In gefährlichen Ländern lässt sich auch Sicherheit herstellen. Indem man mit LKW-Fahrern spricht, Einheimischen, mit Tankwarten, sich Konvois anschließt. Ich habe mich auch schon Rebellen angeschlossen, die mich dann beschützt haben. Aber dafür braucht man auf jeden Fall Fingerspitzengefühl und Erfahrung.
Haben Sie im Laufe der Jahre Tricks entwickelt, welche Ausrüstung vor den extremen Wetterverhältnissen am besten schützt?
Ich habe eine gute Ausrüstung, aber bin nicht over-equipped. Ich bin definitiv kein Ausrüstungsfetischist. Mein Vorbild sind die Einheimischen. Ich bin bis vor kurzem sogar noch mit einfachen Alpaka-Wollhandschuhen gefahren.
Gibt es trotzdem etwas, worauf Sie keinesfalls verzichten würden?
Auf ein GPS-Gerät. Was habe ich früher mit meinen Reisepartnern diskutiert, ob der Berg, den man sieht, auch wirklich der Berg ist, der auf der Karte eingezeichnet ist. GPS ist schon eine große Erleichterung.
Auf Ihren Reisen begegnen Sie sicher immer wieder beeindruckenden Menschen. Gab es eine Begegnung, die Sie besonders in Erinnerung haben?
Fast alle Wüstenbewohner sind sehr starke und warmherzige Persönlichkeiten. Ich bin einmal vom Tschad in den Niger gefahren und habe unterwegs einen uralten Mann in der Wüste getroffen. Der war mit einem Kamel und vier Ziegen unterwegs. Ganz allein. Ich habe ihn gefragt, wohin er wolle. Da hat der Mekka gemurmelt. Er war auf Pilgerreise quer durch die Sahara. Mit einer Decke und einem Kanister Wasser unter dem Arm. Das war schon beeindruckend.
Wie reist man nach solchen Erfahrungen wieder zurück in die Heimat: Haben solche Erlebnisse Einfluss auf Ihr Leben daheim?
Wenn ich Diskussionen erlebe, bei denen es um die letzte Zahl hinter dem Komma bei Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall geht, da denke ich manchmal: Wisst ihr eigentlich, wie gut es uns in Europa geht? Auf meinen Reisen habe ich auch zu schätzen gelernt, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Und auch eine warme Dusche und einen pünktlichen Bus weiß ich nun zu schätzen. Das Reisen schärft immer den Blick für zu Hause und umgekehrt.
Wo macht man als totaler Wüstenfan eigentlich Urlaub? In der Wüste?
Nein, ganz und gar nicht. Wenn ich Urlaub machen möchte, dann finden Sie mich am Gardasee, in der Toskana oder in Tirol.