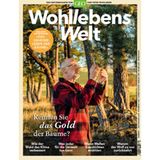Und plötzlich tauchst du ein in einen lebenden Tunnel, das Licht gedämpft, die prachtvollen Baumkronen über dir zu einem grünen Gewölbe geschlossen. Geborgen, beschützt, geleitet — so mag sich fühlen, wer eine Allee durchschreitet. Und tatsächlich stammen die meisten Alleen aus einer Zeit, da Wege noch unbefestigt waren und die grünen Spaliere vor allem eines bieten sollten: Orientierung, auch bei Dunkelheit.
Und so durchziehen Alleen wie Leitschnüre vielerorts die Landschaft, säumen Dörfer, begleiten Wasser- und Landstraßen, bilden prächtige Promenaden in Innenstädten, markieren Zufahrten zu Schlössern oder Gutshöfen.
Ihre Bedeutung für den Menschen reichte aber noch weiter: In Preußen etwa erging um 1750 ein Erlass, nach dem Alleen aus Bäumen angelegt werden sollten, die einen Nutzen hatten. Entlang vieler Ortstraßen reihten die Bewohner daraufhin ungezählte Obstbäume aneinander, die sie mit Früchten und Holz versorgen sollten. Sie pflanzten Kopfweiden, aus deren Trieben sie Körbe und Zäune fertigten. Oder setzten rechts und links ihrer Wege Maulbeerbäume in die Erde: für die Anzucht von Seidenraupen.
Moderner Straßenbau mit Folgen
Heute kann niemand ganz genau sagen, wie viele Alleen im Laufe der Zeit entstanden sind. Zumal etliche an eher wenig befahrenen Feldwegen wachsen, die teils nur Einheimische kennen — oder inzwischen sogar in Vergessenheit geraten sind.
Auch aus diesem Grund hat ein Forscherteam der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde begonnen, bundesweit die Lage und Länge aller Alleen mithilfe von Geodaten wie Luftaufnahmen digital zu kartieren. Ende 2021 soll das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt abgeschlossen sein — und dazu beitragen, Alleen langfristig zu schützen. Denn mehr und mehr von ihnen verschwinden.
Die Gründe sind vielfältig: Streusalz im Winter und Wassermangel in trockenen Sommern setzen den Bäumen ohnehin zu. Doch Naturschützer machen auch eine Bundesrichtlinie zur Sicherheit an Straßen mitverantwortlich. Demnach gilt für Neupflanzungen ein erhöhter Mindestabstand vom Rand der Fahrbahn zum Straßenbaum — was zuweilen auch zur Abholzung bestehender Alleebäume führt.
Alleen sind schützenswerte Ökosysteme
Dabei sind gerade Alleen — insbesondere aufgrund ihres oft hohen Alters — ein unschätzbar wertvolles Refugium für Vögel, Insekten und Kleinsäuger, die in den betagten Kronen Unterschlupf und Nahrung finden. Zudem verbinden die Baumreihen Naturräume wie Haine, Seen und Hecken miteinander. Blühende Lindenalleen bieten reichlich Pollen und Nektar für Bienen. Und manche Obstbaumallee beherbergt Sorten, die es andernorts schon längst nicht mehr gibt. Es bedeutet also auch einen großen ökologischen Verlust, wenn Alleen dem Straßenbau zum Opfer fallen.
Wer schon einmal durch eine verwunschene Eichenallee — zum Beispiel in der Uckermark — geschlendert ist, die Bäume über 200 Jahre alt, die Stämme von Astbeulen übersät, lauter Eichhörnchen, die durch die Kronen flitzen, ahnt: Jeder Kilometer Allee zählt!