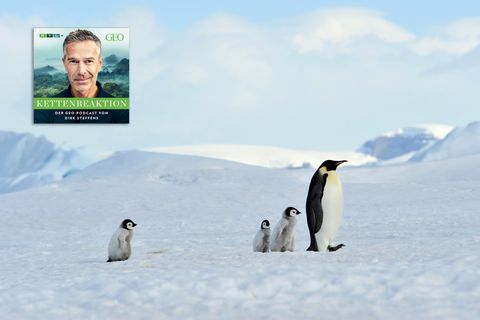Mr. und Mrs. Greedy, Sphen und Magic, Viola und Electra: Besonders innige Pinguinpaare erlangen immer wieder eine gewisse Prominenz. Denn die Tiere sind Romantiker, leben am liebsten in langen monogamen Beziehungen und ziehen in diesen ihren Nachwuchs groß. Balzen sie in der Jugend noch frisch verliebt um die Gunst des anderen, werden sie im Laufe der Jahre zu einem eingespielten Team bei der Brut und Aufzucht der Jungen. Doch auch hier flammen mit der Zeit Konflikte auf, keimt vielleicht die Hoffnung, das Gras wäre woanders grüner oder das Nest weicher. Kommt es dann zur Trennung – oder gar zur endgültigen "Scheidung" – hat das weitreichende Konsequenzen. Und zwar für die gesamte Kolonie.
Denn auch in Zeiten von Lebensraumverlust und Klimawandel lässt sich die Zukunft einer Kolonie am besten anhand der Scheidungsrate vorhersagen, haben Forschende aus Australien, Neuseeland und Deutschland herausgefunden. Sie untersuchten, wie sich marine Umweltvariablen, das Nahrungssuchverhalten und soziale Faktoren wie die Scheidung auf den Fortpflanzungserfolg von Zwergpinguinen (Eudyptula minor) auswirken und veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Ecology and Evolution": Die Scheidungsrate ist demnach der verlässlichste Indikator für den künftigen Fortpflanzungserfolg einer Kolonie.
Bisher wurden Umweltfaktoren und individuelles Verhalten im Hinblick auf den Bruterfolg nur getrennt untersucht. Nun beobachteten die Forschenden alle Faktoren zusammen: in einer Megakolonie am westlichen Ende der australischen Phillip Island, wo zwischen 28.000 und 32.000 Zwergpinguine leben. Die Forschenden statteten die an der Studie beteiligten Pinguine mit Transpondern aus, um sie eindeutig identifizieren zu können und werteten über 13 Brutsaisons hinweg den Inhalt von hundert künstlichen Nestern aus. So konnten sie beobachten, wer mit wem "verheiratet" war, in welchem Nest das Paar Nachwuchs aufzog - und ob es sich wieder trennte.

War die Scheidungsrate vor der Brutzeit niedrig, schlüpften deutlich mehr Küken und wurden erfolgreich flügge. Auch die Dauer der Nahrungsausflüge hatte, durchaus unterschiedliche, Einflüsse auf den Fortpflanzungserfolg: Einerseits führten längere Ausflüge während der Brutzeit zu einem höheren Schlupferfolg, kürzere Ausflüge nach dem Schlüpfen führten andererseits zu einer höheren Erfolgsrate beim Flüggewerden.
Schwierige Partnersuche nach der Scheidung
13 Jahre beobachteten die Forschenden die Pinguine, die Scheidungsrate schwankte während dieser Zeit enorm: Trennte sich in einem Jahr nur jedes 20. Paar, war es in anderen Jahren jedes dritte Paar. Der typische Trennungsgrund: zu wenig Nachwuchs. Dass die Scheidung eines in der Fortpflanzung wenig erfolgreichen Paares zu einem weiteren Einbruch der Geburtenrate führt, scheint damit zusammenzuhängen, dass ein neuer, passender Partner auch im Reich der Zwergpinguine in der Theorie schneller gefunden ist als in der Praxis. Im Durchschnitt findet nur jedes vierte Scheidungspaar innerhalb eines Jahres neue Partner. Bis dann eine Bindung entstanden ist, die stark genug für gemeinsamen Nachwuchs ist, vergeht weitere Zeit – im Zweifelsfall wird auch eine Brutsaison ausgelassen. Ohnehin klappt das Zeugen von Nachwuchs mit dem neuen Partner nicht automatisch besser als mit dem alten – im schlimmsten Fall sogar schlechter.
Im Reich der Pinguine spielen übrigens auch gleichgeschlechtliche Paare eine Rolle, die es in der Vergangenheit immer wieder zu gewisser Berühmtheit gebracht haben: beispeilsweise die beiden männlichen Eselspinguine Sphen und Magic aus dem Sea Life Aquarium in Sydney, die gemeinsam zwei Küken aufzogen. Auch in freier Wildbahn tragen gleichgeschlechtliche Paare zum Fortpflanzungserfolg der Kolonie bei. Sie brüten jene Eier aus, um die sich die leiblichen Eltern nicht kümmern können.