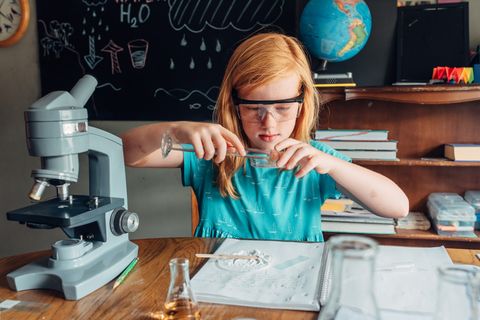Der Mensch liebt Label. Helikoptereltern umschwirren ihren Nachwuchs pausenlos und überwachen jeden Schritt. Rasenmähereltern räumen jedes Hindernis und jede potenzielle Quelle der Frustration aus dem Weg. U-Boot-Eltern bleiben weitgehend auf Tauchstation, sind aber, wenn sie denn auftauchen, widerborstige Zeitgenossen.
Beliebt sind auch Anleihen bei der Natur. Löwen- und Rabeneltern gibt es im deutschen Sprachschatz schon lange; neu dazugekommen im Zoo der Erziehungsstile sind Tiger, Quallen und Delfine. Doch wie ziehen diese Tiere eigentlich ihre Kinder groß?
Löwenmütter: Kampf den mörderischen Männchen
Löwenmütter tun alles in ihrer Macht Stehende, um den Nachwuchs zu beschützen. In der Tierwelt wie in der Menschenwelt geht die größte Gefahr dabei oft von Artgenossen aus. Übernehmen neue Männchen die Macht im Rudel, töten sie die zu säugenden Jungen ihrer Vorgänger, um den Eisprung der Weibchen auszulösen. Rund ein Viertel aller Löwenjungen verlieren auf diese Weise das Leben.
Der Kampf der Mutter um die Sicherheit ihrer Jungen beginnt deshalb bereits bei der Empfängnis. Läufige Löwinnen paaren sich sehr oft – nicht nur mit dem Anführer des Rudels, sondern bei Gelegenheit auch mit anderen Männchen. So können sie die Vaterschaft verschleiern. Hatte ein potenzieller neuer Rudelführer bereits Sex mit einem Weibchen, verschont er dessen Nachwuchs womöglich – es könnte ja der eigene sein.
Rührende Einblicke in die Kinderstube wilder Tiere

Rührende Einblicke in die Kinderstube wilder Tiere
Auch der Zusammenhalt unter den (oft eng verwandten) Rudelgenossinnen bietet Schutz. Löwinnen ziehen ihre Jungen gemeinsam groß, behalten den Nachwuchs der anderen Weibchen im Auge und säugen ihn gelegentlich. Männchen, die sie als Bedrohung wahrnehmen, schlagen sie im Team in die Flucht. Auch der Vater hält mordlustige Konkurrenten nach Kräften in Schach. Den Löwenanteil der Care-Arbeit übernehmen jedoch die Mütter.
Das bedeutet übrigens nicht, dass sie ihr eigenes Überleben hinter das ihrer Jungen stellen. Schließlich können sie den Fortbestand ihrer Gene am besten sichern, wenn sie selbst fit und fortpflanzungsfähig bleiben. So lassen ausgehungerte Löwenmütter schwächelnde Junge gelegentlich zurück.
Rabeneltern: besser als ihr Ruf
Rabeneltern, so heißt es, vernachlässigen die Bedürfnisse ihrer Jungen aufs Schändlichste. Mit der biologischen Realität hat dieses Image jedoch wenig zu tun. Die klugen Krähenvögel formen dauerhafte Partnerschaften und kümmern sich gemeinsam um die Küken. Die kommen blind, nackt und unersättlich zur Welt. Kaum geschlüpft, sperren sie den Schnabel auf. Ihre Eltern füllen ihn fortan fleißig mit hochgewürgtem Futter. Von Vernachlässigung kann keine Rede sein. Tatsächlich wären die Nesthocker ohne die Fürsorge der Eltern gar nicht überlebensfähig.
Der schlechte Ruf geht womöglich auf Rabenjunge zurück, die aus dem Nest gestürzt sind und am Boden hilflos und orientierungslos wirken. Doch auch hier sind die Eltern meist in der Nähe und versorgen die Küken weiterhin. "Ihr Rabeneltern!" ist in Wahrheit also ein Kompliment.
Tigereltern: Eine gute Ausbildung ist alles
In der Menschenwelt sind Tigereltern streng und besessen vom akademischen oder sportlichen Erfolg ihres Nachwuchses. Auch echte Tigerjunge müssen bereit sein zu lernen, schließlich hängt ihr Überleben davon ab. Ihre Mutter bringt ihnen bei, wie man sich an Beutetiere heranschleicht, sie angreift und tötet. Zwischen anderthalb und zwei Jahren dauert die Ausbildung. Währenddessen darf das Spiel nicht zu kurz kommen, denn beim Rangeln erproben die Jungen wichtige Fähigkeiten.
Während sie die kleinen Racker großzieht, muss die Mutter rund 50 Prozent mehr Beute machen. Schließlich stopft sie im Schnitt zwei bis drei hungrige Mäuler mehr. Der Vater hat damit nichts zu tun: Tiger sind Einzelgänger, die nach der Paarung umgehend getrennte Wege gehen.
Qualleneltern: Jede zweite Generation ist geklont
Qualleneltern passen sich den Bedürfnissen ihrer Kinder an und leisten dabei, ähnlich wie die Glibberwesen, keinen nennenswerten Widerstand. Interessanterweise hat der Lebenszyklus echter Quallen wenig mit menschlichen Vorstellungen von Brutpflege zu tun.
Schauen wir uns beispielhaft die ebenso häufige wie harmlose Ohrenqualle an. Sie pflanzt sich geschlechtlich fort: Männchen entlassen ihre Geschlechtszellen ins Wasser, in der Hoffnung, dass diese einem Weibchen über den Weg treiben. Kommt es zur Befruchtung, reifen die Larven zunächst in einer Bruttasche der Qualle heran, bevor sie ausgestoßen werden.
Anstatt ziellos durchs Wasser zu treiben, setzen sie sich nun am Grund fest und werden zu sesshaften Polypen. Diese schnüren weibliche oder männliche Klone ihrer selbst ab, die sich erneut zu Medusen entwickeln. Dann beginnt der Kreislauf von Neuem. Was uns dieser zweistufige Lebenszyklus für die Erziehung von Menschenkindern lehrt? Vielleicht, dass die richtige Mischung aus Nachgiebigkeit und Beharrlichkeit zum Erfolg führt. Selbst, wenn man kein Rückgrat hat.
Delfineltern: Entspannt trotz Schlafentzug
Firm, flexibel und liebevoll: Menschliche Delfineltern bieten Sicherheit, Freiraum und Grenzen. Kein Wunder, dass ein maximal sympathisches Tier für diesen Erziehungsstil Pate stand. Dabei weichen Große Tümmler nicht selten von konservativen Moralvorstellungen ab. So auch bei der Fortpflanzung: Mal umwirbt ein einzelnes Männchen das empfängnisbereite Weibchen, mal tut sich eine Gruppe zusammen, um sie von ihrer Schule zu isolieren und sich nacheinander mit ihr zu paaren.
Nach der Geburt geht es konservativer zu. Dann ist die Mutter weitgehend für das Wohlergehen ihres Kalbes zuständig. Sie säugt es bis zu 20 Monate lang, lässt es in der Druckwelle seitlich ihres Rumpfes mit schwimmen und hat sogar ein spezielles Geräuschrepertoire für das Kleine in petto – Baby-Talk, sozusagen.
Die Delfinkälber selbst wären übrigens der absolute Albtraum jedes menschlichen Elternteils. 2005 zeigte eine Studie, dass sie in den ersten Wochen nach der Geburt keine Minute schlafen. Sie sind pausenlos wach, um zu schwimmen, ihre Mutter im Auge zu behalten und an der Oberfläche Luft zu holen. Entsprechend wenig Ruhe bekommt auch das Weibchen. Im Gegensatz zu menschlichen Eltern scheint es den Schlafentzug jedoch gut zu verkraften.