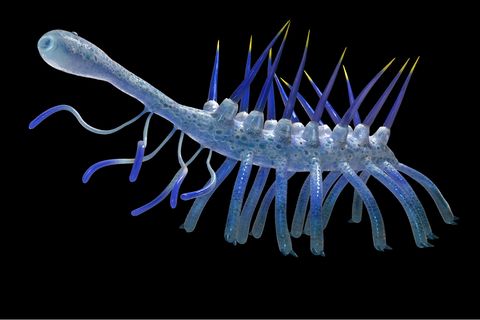Die Welt ist voller Augen. Ganz gleich, wo man hinblickt, meist äugt irgendwer zurück. Allein mehr als 15 Milliarden Menschenaugen betrachten rund um den Erdball die Umgebung. Hinzu kommen unzählbar viele Tieraugen. Am Himmel kreisen Falken, Bussarde und Adler, die Mäuse noch auf mehrere Hundert Meter Entfernung scharf sehen. Die Nager wiederum sind geübt darin, den Schatten der Greifvögel so schnell wie möglich zu erkennen, um rechtzeitig zu entkommen.
Im Gebüsch funkeln die Augen von Füchsen, Hasen, Rehen, Mardern. Schmetterlinge und Libellen, Käfer, Bienen und Fliegen, die vorbeisurren, sind mit komplexen Sehorganen ausgestattet, die mitunter aus jeweils Tausenden winzigen Einzelaugen zusammengesetzt sind. Manche Spinnen betrachten die Welt durch zwei Hauptaugen und sechs Nebenaugen, die ihnen sogar einen 360-Grad-Rundumblick ermöglichen. Selbst Würmer können sehen, ebenso erblicken Schnecken und Flöhe, Motten und Maden, Egel und Asseln die Welt.
Sehen bedeutet überleben
Der Großteil der Tiere also nutzt jenen Sinn, der auch den meisten Menschen der wertvollste ist. Sehorgane sind in der Evolution wohl mehr als 40 Mal unabhängig voneinander entstanden; Biologen unterscheiden Dutzende Augentypen. Denn sehen zu können ist eine Fähigkeit, die einen immensen Überlebensvorteil mit sich bringt. Kein Signal liefert mehr Informationen über die Welt als Licht.
Wer die energiereichen Strahlen erfassen kann, der weiß, ob es Tag oder Nacht ist, Zeit also zum Schlafen oder zum Jagen. Der erkennt, wo im Raum er sich befindet, wo eine nahrhafte Frucht am Baum hängt, wo er langlaufen kann, ob vor ihm ein Stein liegt, über den er stolpern könnte.
Ein Blick kann verraten, ob man sich unter Freunden oder Feinden befindet. Ob Gefahr droht, sich ein Parasit nähert, ein Räuber anschleicht. Und: Wer bessere Augen hat als ein anderer, der mag die entscheidende Sekunde früher vor einem Angreifer fliehen – und überleben.