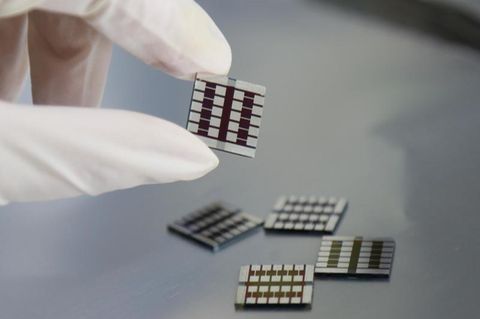Mit ihrer zukünftigen Windkraftpolitik hat die Rot-Grüne Landesregierung von Rheinland-Pfalz schon jetzt einen Sturm entfacht. Eine Allianz sämtlicher Naturschutzverbände wendet sich vehement gegen einen neuen Gesetzentwurf zum Landesentwicklungsprogramm LEP-IV.
"Dass die Abkehr vom Atomstrom Opfer verlangt, ist uns klar", sagt Dr. Peter Keller, Vorsitzender der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR). "Aber das heißt nicht, dass die Politik fast sämtliche Hemmnisse aufgeben darf bei der Genehmigung von Windenergieanlagen!"
Die Verbände befürchten, dass die Vorlage "zu einer ungesteuerten gießkannenmäßigen Verteilung der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz" führen werde, und dass es "mittelfristig keine Sichtperspektive ohne Windräder mehr geben wird". Explizit ausgenommen seien einzig Kernzonen wie etwa zwei Prozent des Biosphärenreservates Pfälzerwald oder einige Naturschutzgebiete.
Überall sonst könnten Giganten von 150 bis 200 Meter in den Himmel ragen. Weil nur in dieser Höhe - vergleichbar in etwa mit jener des Kölner Doms - der Wind stark genug bläst, um den nötigen Ertrag zu bringen.
Windkraft soll verfünffacht werden
Dabei sieht es nach einem solchen dramatischen Szenario in dem Entwurf zum LEP IV auf den ersten Blick gar nicht aus. Im Gegenteil: Explizit, so heißt es in der Vorlage, werde eine "stärkere Steuerung ermöglicht, ... um eine gebündelte Nutzung zu erreichen und räumlich ungesteuerte Entwicklungen zu vermeiden". Zwar sollen der jetzt bereits hohe Anteil an Windenergie in Rheinland-Pfalz verfünffacht und dafür zu den existierenden 1300 noch etwa 1700 bis 2000 neue Windenergieanlagen (WEA) eingerichtet werden. Dennoch sind nur zwei Prozent der Landesfläche vorgesehen, um das Ziel zu erreichen, mittels Windkraft und anderen alternativen Energien gegen 2030 Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen erhalten zu können. Das deckt sich mit einer Einschätzung der Windindustrie, die zwei Prozent der Landesflächennutzung als "realistisch" ansieht - darin inbegriffen wären etwa zwei Prozent Waldfläche.

Kritiker befürchten Wildwuchs
Diese Ziele finden auch die Zustimmung der GNOR, sagt Keller. Nur gebe es in der Vorlage keine einzige verbindliche Regelung von Seiten der Landesregierung, die möglichem Wildwuchs Einhalt gebieten kann. Die Planungshoheit liegt jetzt nämlich bei den Verbandsgemeinden. Das Problem: "Wenn es da um Einnahmequellen für einen Bezirk geht, wird jede Gemeinde versuchen, davon zu profitieren - ohne Rücksicht auf das Umfeld." Ähnlich etwa wie bei der Ausweisung von Gewerbegebieten: Die gibt es heute fast in jeder Gemeinde, ausgelastet sind sie aber nicht. Auf dem gleichen Weg könnte sich bald ein WEA-Flickenteppich übers Land ziehen - anstelle einer Bündelung auf wenige Standorte.
Tatsächlich: Laut Wolfgang Wenghoefer, Vorsitzender der Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt in Rheinland-Pfalz, "stellen bereits jetzt viele Gemeinden in Regionen mit Raumordnungsplänen ohne Teilplan Windkraft Bauanträge für Windkraftanlagen - und zwar ohne dabei die Belange des Naturschutzes und den Erholungswert der Landschaft ausreichend zu berücksichtigen." Dass es so kommen könnte, befürchtet auch Andreas Grauer von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz (SDW). "Ein Bürgermeister einer Gemeinde in einer strukturschwachen Region wird sicherlich jede Chance nutzen, zusätzliche Einnahmen zu generieren. In vielen Regionen stehen die Gemeinden finanziell mit dem Rücken an der Wand."
Alternativen sind möglich
Aber es gäbe dennoch Alternativen: Schon jetzt haben sich manche Gemeinden im Hunsrück zu einem Solidarpakt zusammengeschlossen, um die Mittel für Kindergärten und andere Einrichtungen untereinander zu verteilen, wenn einige Kommunen auf eigene Windkraft-Projekte verzichten. Zum Besten des Waldes und des Landschaftsbildes sei es jedenfalls, etwaige WEA an ökologisch weniger sensiblen Orten zu zentralisieren, meint Grauer. "Und das geht am besten über eine übergeordnete Planung. Dann sind auch die angestrebten zwei Prozent der Waldfläche, die für die Windkraft vorgesehen sind, aus unserer Sicht vertretbar." Wobei es über Kriterien für den Ausschluss und das Ausmaß der Beeinträchtigung der Landschaft unterschiedliche Meinungen gibt: Der Regionalplanmanager der Windkraftfirma JuWi, Michael Lüer, behauptet zum Beispiel, man könne im Wald vor lauter Bäumen die Anlagen nicht sehen - und hören schon gar nicht. Denn der Wald rauscht. Ähnlich steht es im Entwurf.
Windkraft kontra Tourismus
Was aber ist mit den Trassen und Schneisen? Der Wald würde zerschnitten - und auf jeder Lichtung wäre der Blick auf die Monstren frei. Eine Touristenattraktion sieht anders aus - viele Pfälzer fürchten ein Ausbleiben der Besucher, die die Landschaft und die Ruhe genießen wollen. Die Verbände fordern jedenfalls bereits heute klare regionalplanerische Vorgaben, wo gebaut werden darf und wo nicht. Das ist jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil: Bisherige Ausschlusserklärungen, wie sie etwa von der Regionalplanung Westpfalz und Rheinhessen-Nahe im Konsens aller Betroffenen erlassen worden sind, würden durch die LEP-IV-Neufassung Makulatur. Und wenn erst einmal gebaut worden ist, kann das Gebiet nicht mehr im Nachhinein als schützenswert ausgewiesen werden.
Warum geht ausgerechnet die Rot-Grüne Landesregierung trotz zahlreicher Vermittlungsgespräche diesen Weg? Manche vermuten, dass insbesondere auf die Grünen der Erfolgsdruck lastet, die Energiewende rasch vollziehen zu können - und dafür müssen Beschränkungen möglichst klein gehalten werden. Dabei wäre es sinnvoller, sich nicht das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Man könnte zunächst versuchen, ohne sensible Gebiete zu berühren, das Projekt rasch voranzutreiben, meinen Wenghofer und Keller. Dann könne man, falls sich herausstellte, dass die weniger sensiblen Flächen nicht ausreichen, in einigen Jahren noch einmal nach verhandeln. Keller: "Stattdessen beginnt man damit, zunächst die Einschränkungen in sensiblen Gebieten zu hinterfragen und nach Ausnahmetatbeständen zu suchen."
Hat der Naturschutz das Nachsehen?
Selbst bei bereits geschützten Räumen hat die Politik offenbar wenig Bedenken. In der Gegend um den Kleinen Bühl bei Wattenheim wurde unlängst für mehrere Millionen Euro ein "Grüner Korridor" errichtet, der zum Beispiel Wildkatzen das Streifen durch den Pfälzerwald ermöglichen soll. Nun ist laut dem Regionalplan Rhein-Neckar unter der Bezeichnung DÜW-VRG-02-W ein 73 Hektar großes WEA-Gelände in Betracht, mit 15 bis 20 Riesenwindrädern, das noch nicht einmal 3000 Meter Abstand zum Korridor hält. Die ökologischen Folgen lassen sich voraussehen - aber nicht einschätzen, weil man über Windkraftschäden noch viel zu wenig weiß, heißt es im Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz.
Ausgesprochen vorauseilend war auch der Entschluss, die Rodung von Flächen im Hunsrücker Soonwald nahe der Gemeinde Ellern zu gestatten, einer Zone, die sogar explizit als Naturschutzgebiet im Gespräch war. Die Rodung sollte nicht zur Brutzeit stattfinden, doch man wollte nicht ein Jahr warten. Also erlaubten die Struktur- und Genehmigungsdirektion sowie das rheinland-pfälzische Umweltministerium das Vorhaben, obwohl es noch gar keinen Ratsbeschluss dafür gab: Der sei ja absehbar positiv gewesen, sagt Landrat Bertram Fleck (CDU). Relativ wenige Bedenken dürften auch speziell Gemeinden haben, die an ganz anderer Stelle viele Hektar Wald besitzen - wie etwa Landau oder Ingelheim.
Nach einer "verträglichen Lösung" wird gesucht
Unterdessen versichert die Pressesprecherin des Wirtschaftsministeriums, Stefanie Mittenzwei, es sei doch selbstverständlich, dass die Rot-Grüne Regierung "nach einer verträglichen Lösung" suche, die die Naturschutzklientel nicht verprelle. In einigen Monaten sei ein überarbeiteter Entwurf geplant, der Einwände berücksichtige und allen Beteiligten wiederum vorgelegt werde. "Dabei wird auch überlegt werden, ob weitere Ausschlussgebiete benannt werden können." Man wolle den Gemeinden aber den eigenen Gestaltungsraum überlassen. Die sich selbstverständlich auch an Umweltgesetze halten und um Bedenken der Bevölkerung und der Touristikbranche kümmern müssten. "Die Gemeinden sind Partner der Landesregierung bei der ökologischen Energiewende. Würde man dirigistisch vorgehen und die Gemeinden bevormunden, wäre der Aufschrei ebenfalls groß."
Ein aktueller Antrag der CDU-Landesfraktion vom 12.8.2012 fordert die Regierung sogar explizit auf, einen "Masterplan" zu einer "überregionalen Koordination" zu erstellen - ganz im Sinne der Naturschutzverbände.
Also einfach abwarten und auf das Beste hoffen? Leider erlaubt die kommunale Lösung es auch, bei Fehlplanungen den Schwarzen Peter an die Gemeinden weiterzureichen. Und es ist ungleich schwerer für die Verbände, etwaige Prozesse anzustrengen, wenn es keine übergeordnete Regelung gibt. Zumal es seit geraumer Zeit fast keine Artenbestandsaufnahme mehr gibt: "Daher wissen wir gar nicht, was wo zu schützen wäre", sagt Peter Keller.
Bedenklich stimmt zudem, was im Papier der Windindustrie zu lesen ist. Dass man realistischerweise zwar nur von zwei Prozent der Landesfläche ausgehen könne. Man aber unbedingt versuchen müsse, strenge Auflagen bezüglich der Höhe und dem Standort von Windkraftanlagen zu Fall zu bringen. Angesichts knapper Kassen haben die Politiker dieses Signal offenbar verstanden. Damit das Land letztlich, so der Plan, sogar überschüssigen Strom exportieren kann.
Nabu-Stellungnahme zum Entwurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV)
So beurteilt der Bundesverband WindEnergie e.V. das Windenergiepotenzial in Rheinland-Pfalz
Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz (BfN)
Die Homepage der Bürgerinitiative "Gegen die Windgiganten"