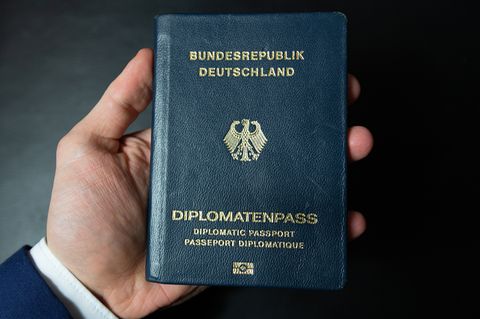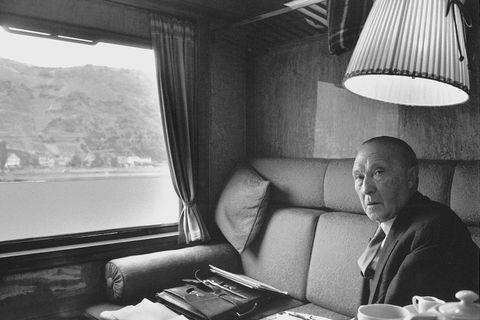GEO: Wie hängt für Sie Biodiversität mit Entwicklungszusammenarbeit zusammen?
Dr. Gerd Müller: Artenvielfalt ein zentrales Thema für die Entwicklungspolitik – genauso wie der Klimaschutz. Ein Beispiel: Das Überleben von 700 Millionen Menschen hängt vom Meer und der Fischerei ab. Vor allem für Menschen in Entwicklungsländern. Aber ein Drittel aller Fischbestände weltweit sind überfischt. Die Hälfte der Mangrovenwälder wurde bereits abgeholzt, die unverzichtbar für das Aufwachsen der Jungfische, den Küstenschutz und die CO2-Bindung sind. Das zeigt: ohne intakte Pflanzen- und Tierwelt ist auch keine Entwicklung möglich. Die Erde kommt auch gut ohne uns aus: Hunderte Millionen Jahre gab es ein vielfältiges Tier- und Pflanzenleben, bevor der Mensch kam. Wenn man die Erdgeschichte auf 24 Stunden reduziert, dann ist der Homo Sapiens erst die letzten drei Sekunden auf den Planeten getreten. Deswegen sollten wir mehr Demut gegenüber der Schöpfung, der Natur haben.
Aber welche Rolle nimmt die Entwicklungszusammenarbeit im Erhalt der Biodiversität ein?
Unsere wichtigste Aufgabe ist die Sicherung des Überlebens der Menschen, die Beendigung von Hunger, Armut und Elend in der Welt. Das gelingt nur, wenn wir unser Leben in Balance mit der Natur gestalten. Wenn wir durch unser Wirtschaften, unseren Konsum das Ökosystem zum Kippen bringen, dann sterben nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern am Schluss der Kette sicher auch der Mensch. Durch die Zerstörung der Wälder etwa schreitet der Klimawandel schneller voran, Biodiversität nimmt ab und damit auch die Ernährungsgrundlage für Millionen Menschen. Deswegen investieren wir massiv in den Erhalt der natürlichen Ressourcen.
Zum Beispiel im Amazonasgebiet. Ich war dort und habe mit der indigenen Bevölkerung gesprochen wie wir unsere Schutzprogramme ausbauen können. Insgesamt unterstützen wir 600 Schutzgebiete in über 50 Ländern – das ist eine Fläche viermal so groß wie Deutschland. Wir fördern auch große Meeresschutzprogramme wie den Blue Action Fund. Damit haben wir bereits 200.000 Quadratkilometer Meeresgebiete unter Schutz gestellt. Das wollen wir verdoppeln. Und wir setzen uns unter anderem mit dem WWF dafür ein, dass der Mangrovenbestand wieder zunimmt.
Wie können solche Projekte in Entwicklungsländern besser gelingen als bei uns? Wir haben in Deutschland ja bereits große Probleme wie intensive Landwirtschaft oder das Insektensterben.
Indem wir die Länder unterstützen, einen nachhaltigen Entwicklungsweg einzuschlagen. Das betrifft nicht nur die Landwirtschaft. Das muss sich auch in der Frage des nachhaltigen Wirtschaftens umsetzen. Der globale „Erdüberlastungstag“ war 2019 bereits am 29. Juli. Für den Rest des Jahres leben wir gewissermaßen „auf Pump“. Würden alle Menschen so leben und konsumieren wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Das kann kein Vorbild für Entwicklungsländer sein. Wir brauchen ein neues Wachstumsmodell – weltweit!
Dazu muss jeder bei sich selber anfangen. Und sich fragen: Wie konsumiere ich? Welche Konsequenzen hat das? Die meisten beginnen den Tag mit einer Dusche. Im Shampoo steckt Palmöl. In jedem zweiten Supermarktartikel ist heute Palmöl verarbeitet. Es kommt größtenteils aus Indonesien und Malaysia, wo noch immer die Regenwälder dafür brennen. Deswegen fordere ich, dass nur noch Palmöl von zertifizierten Flächen in die EU darf.

Glauben Sie, dass es gelingt, neun Milliarden Menschen zu ernähren und die Artenvielfalt zu erhalten? Und wenn ja, wie?
Ja - eine Welt ohne Hunger ist möglich. Das Wissen, die Technologien dafür sind vorhanden. Aber vier von fünf afrikanischen Bauern bestellen ihr Land noch immer von Hand. Ein Ochsenpflug ist selten, eine Motorhacke quasi High Tech. Deswegen brauchen wir Quantensprünge in der Produktion: durch angepasste, ökologische Formen der Landwirtschaft. Unsere Erde bietet eine große Pflanzen-, Boden- und Sortenvielfalt. Dieses Potenzial wollen wir gemeinsam mit den Bauern vor Ort nutzen. In Großstrukturen zu investieren, wo die Bulldozer anrücken - das kann nicht die Zukunft sein.
Also eine Stärkung der lokalen Strukturen und der lokalen Bauern?
Ganz genau. Entscheidend ist eine Entwicklung von unten, von den bäuerlichen Familien ausgehend. Deswegen stärken wir lokale Strukturen. Etwa mit Kooperationen und Genossenschaften, wie wir sie vor 150 Jahren auch in Deutschland, in der Raiffeisen- und Genossenschaftsbewegung entwickelt haben: gemeinsam einkaufen, arbeiten und verkaufen. Aber es wird nicht funktionieren, einfach 1:1 westeuropäische Modelle nach Afrika oder Asien zu übertragen. Es gilt vielmehr nachhaltige Methoden im Einklang mit der örtlichen Bevölkerung zu entwickeln.
Haben sie ein, zwei sehr konkrete Maßnahmen, die sich als erfolgreich bei der Erhaltung von Biodiversität erwiesen haben?
Ganz wichtig ist Wissenstransfer: Wie gelingt Ernährung im Einklang mit den natürlichen Grundlagen Boden und Wasser sowie dem Erhalt der Pflanzen- und Tierwelt? Wir haben dazu unter anderem 16 Grüne Innovationszentren in Afrika, Indien und Vietnam aufgebaut. Eine Million Kleinbauern profitieren bereits davon. Gemeinsam mit internationalen und nationalen Forschungsinstituten arbeiten wir an konkreten Innovationen. Im Benin haben wir beispielsweise klimaangepasste Reissorten eingesetzt und die Aussaat sowie die Bewässerung optimiert. Mit einfachen Mitteln, ohne Gentechnik konnte der Ertrag verdoppelt werden - auf vier Tonnen pro Hektar. Solche Fortschritte verringern massiv den Druck auf noch intakte Ökosysteme.
Ein weiteres Beispiel ist Mauretanien, das über sehr reiche Fischgründe verfügt. Diese sind durch große Fangflotten stark bedroht. Mit einer modernen Fischereiüberwachung und satellitengestützten Systemen unterstützen wir die Regierung beim Kampf gegen illegale Fischerei. Und wir helfen gleichzeitig, eine nachhaltige Fischereiwirtschaft aufzubauen.
Ist das Bewusstsein für Biodiversität generell gewachsen in den letzten Jahren? Merken Sie das in der Entwicklungszusammenarbeit?
In den afrikanischen Ländern bemerke ich sehr viel Offenheit für das Thema. Die Menschen wissen: Was mir die Erde, der Boden gibt, das ist mein Leben, das ist meine Zukunft. Aber ich sehe natürlich auch die Herausforderungen: Große Investoren, die sich Land sichern und Zäune drum herum bauen. So werden wir schon bald Kriege um die natürlichen Ressourcen führen. Umso wichtiger ist, dass die Staatengemeinschaft beim Schutz der biologischen Vielfalt schneller vorankommt. Im Oktober bietet sich dazu eine große Gelegenheit: Beim Treffen der Vertragsstaatenkonferenz in China soll eine neue 10-Jahresstrategie zu Biodiversität verabschiedet werden. Hier muss einen Durchbruch gelingen – ähnlich dem Pariser Abkommen für den Klimaschutz.