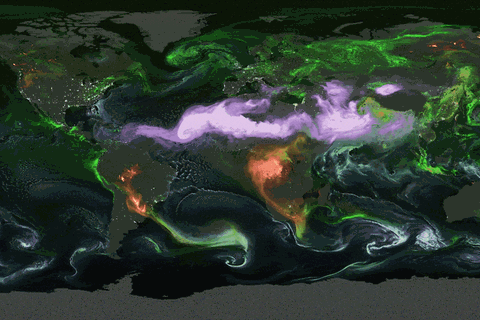An manchen Tagen im Frühjahr, wenn der Wind von Süden weht, beginnt der Himmel über den Alpen zu bluten. Dann fällt Regen in feurigem Rot und lässt die Berge dunkel leuchten. Im Mittelalter fürchtete man, der "Blutregen" sei ein Vorbote für Pestilenz und Siechtum.
Mitte des 19. Jahrhunderts fand Christian Gottfried Ehrenberg, Rektor der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität, eine Erklärung für das unheimliche Phänomen: Er entdeckte Hunderte mikroskopisch kleiner Teilchen in einem rotbraunen Belag, den der Regen auf der Erde zurückließ. Darunter waren winzige Bruchstücke von Muschelschalen, die Ehrenberg aus Nordafrika kannte.
Sie ließen den Forscher schließen, dass Passatwinde rötlichen Saharastaub bis nach Europa treiben, wo er vom Niederschlag ausgewaschen wird. Es sei "ein großes organisches unsichtbares Wirken und Leben in der Atmosphäre", so überschrieb der Pionier der Staubforschung eine Abhandlung von 1847.
Luft ist damals ein noch wenig untersuchtes Medium, doch Ehrenbergs Analysen deuten bereits darauf hin, dass es sich um weit mehr handelt als eine simple Melange aus Stickstoff, Sauerstoff und ein paar Edelgasen. "Es ist nur der Anfang einer künftigen großen Erkenntnis", resümiert der Wissenschaftler gegen Ende seines Werkes.