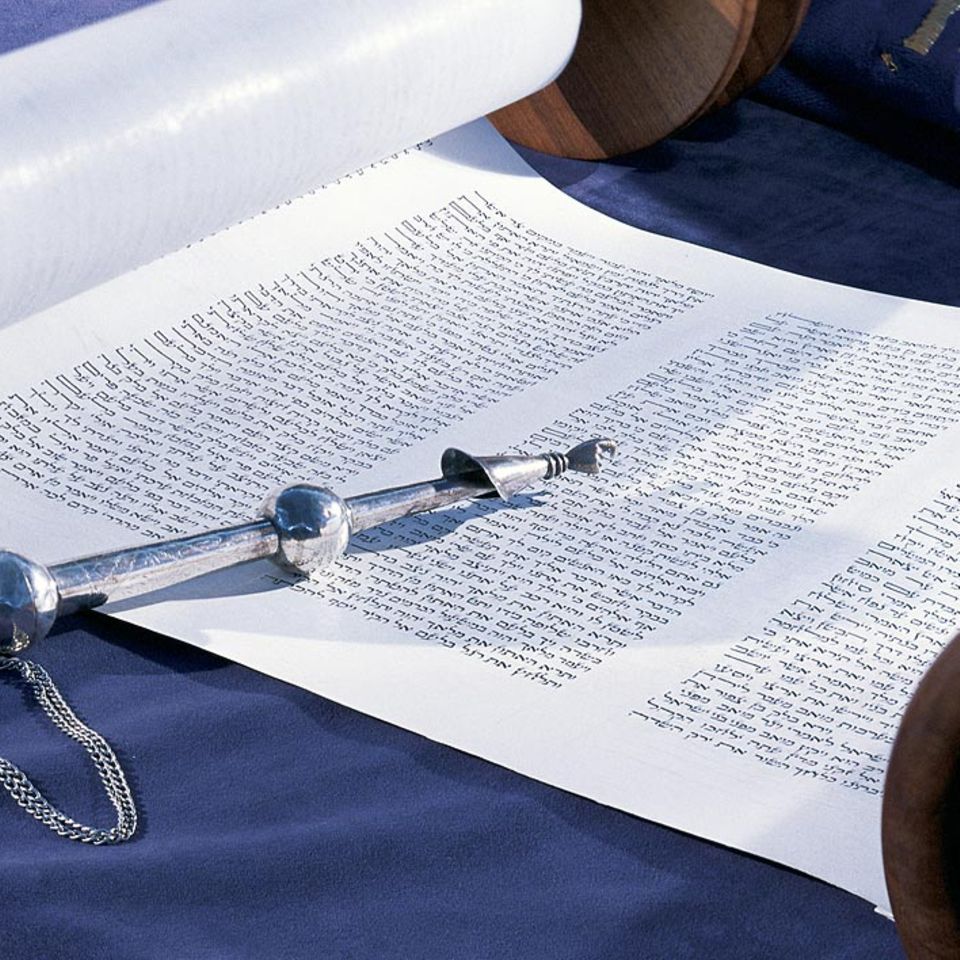Die darf den Herrscher besuchen, wann immer sie will. Seine Leute, so hat der Monarch es befohlen, sollen sie jederzeit vorlassen. Für Friedrich I., König in Preußen, erledigt diese energische Frau ja auch fast alles, was von Belang ist. Sorgt für Glanz und Luxus, beschafft Edelsteine, Gold und Schmuck, ausgefallenes Essen, Kutschen und feine Tinkturen. Sie beliefert die königlichen Baustellen zuverlässig mit Material und organisiert sogar das für die Wirtschaft so wichtige Münzwesen des Staates mit. Kurz: Keine Frau in Preußen ist um das Jahr 1700 so einflussreich wie Esther Liebmann – vor allem keine Jüdin.
Früher haben Vorfahren des Königs Juden aus ihren Städten und Landen vertrieben, sie zum schlechten Einfluss, zu gefährlichen, unerwünschten Fremden erklärt. Doch in den letzten Jahrzehnten haben sich die Zeiten geändert: Die barocken Höfe haben einen gewaltigen Bedarf an Luxusgütern und Kapital; zudem führen die Herrscher nun erstmals wachsende moderne Staatsapparate mit zentraler Verwaltung und stehendem Heer. Sie benötigen Geld, kundige Finanzplanung, gutes Management der entstehenden Staats haushalte. Und so wenden sich viele Fürsten unter anderem an Juden.
Die halten als Geschäftsleute oft Kontakt über Landesgrenzen hin aus – ein Vorteil für jene neue Tätigkeit, die sich ihnen nun überall in Deutschland bietet: Sie sollen die Versorgung der Höfe und Heere mit Gütern übernehmen und die Staatsfinanzen organisieren. Schnell erreichen manche von ihnen eine privilegierte Stellung. Und einen eigenen Titel: Hoffaktor (oder „Hofjude“).
Esther Liebmann und ihre Gatten
Esther Liebmann ist nacheinander Gattin von gleich zwei Hofjuden – und die Ehen sind wie Lehrjahre für sie. Ihr erster Mann versorgt die Armee, liefert dem Hof Sil ber und Wein, Gewürze und Zugtiere. Die attraktive, diplomatisch geschickte, hochehrgeizige Frau stammt aus einer prominenten Prager Familie und macht in Berlin schnell auf sich aufmerksam. Als ihr Gatte 1673 stirbt, sind ihre eigenen Kontakte längst so gut, dass sie selbst den Titel der Hofjüdin verliehen bekommt – die perfekte Mitgift für ihren zweiten Mann.
1677 heiratet sie erneut, den jüdischen Juwelenhändler Jost Liebmann, der dank ihrer Verbindungen bald ebenfalls als Lieferant des Berliner Hofes reüssiert. Immer stärker treten die Eheleute nun als Gespann auf: Esther Liebmann reist mit ihrem Mann zu wichtigen Messen, kümmert sich mit ihm um den Edelsteinhandel. Um 1700 gilt Jost Liebmann mit einem Vermögen von 100 000 Reichstalern als der reichste Jude Deutschlands.
Erfolgreicher als je zuvor
Als auch er 1702 stirbt, führt seine Frau die Geschäfte allein weiter – und ist erfolgreicher als je zuvor. Denn kurz vorher hat sich der Herrscher Preußens feierlich zum König gekrönt. Mehr denn je braucht er nun repräsentative Kostbarkeiten, die seinen Hof glänzen lassen. Die Witwe und der Monarch werden zu idealen Partnern; sie beschafft ihm – neben vielem anderen – die Geschenke für die Staatsgäste: goldenes Geschirr, diamantgeschmückte Schnupftabak dosen, strahlende Juwelen.
Weil sich Friedrich I. immer höher bei seiner Lieferantin verschuldet, gewährt er ihr im Gegenzug das Recht zur Münzprägung. Esther Liebmann erwirbt, wie andere Münzmeister ihrer Zeit, die benötigten Edelmetalle vermutlich auf den internationalen Märkten und prägt Millionen Sechspfennigstücke für Preußen, bei deren Ausgabe sie dann Geld verdient.
Liebmann und König Friedrich I.
Damit ist sie eine der ersten Frauen Europas, die das Finanzsys tem ihres Landes mitgestalten. Doch die enge Bande zum König erweist sich schließlich als verhängnisvoll: Als Friedrich I. im Jahr 1713 stirbt, fällt sie mit ungeheurer Wucht.
Der Thronfolger, Friedrich Wilhelm I., verabscheut die Geldverschwendung seines Vaters – und offenbar auch alle Personen, die dies ermöglicht haben. Er setzt Esther Liebmann zehn Wochen unter Hausarrest und lässt sie (wohl zu Unrecht) wegen Betrugs anklagen.
Sie kämpft vor Gericht, muss dem Hof am Ende jedoch eine gewaltige Summe zahlen. Sie bleibt wohlhabend, aber ist, so scheint es, gebrochen. Hinzu kommt die Häme vieler Christen, die die Macht der Jüdin nie akzeptiert haben.
Nur ein gutes Jahr nach Friedrich I. stirbt auch die ehemalige Hofjüdin. Doch die Verbindung zu ihrem mächtigsten Verbündeten bewahrt sie über den Tod hinaus: Sie lässt sich eine goldene Kette, das kostbarste Geschenk des Königs an sie, mit ins Grab legen.