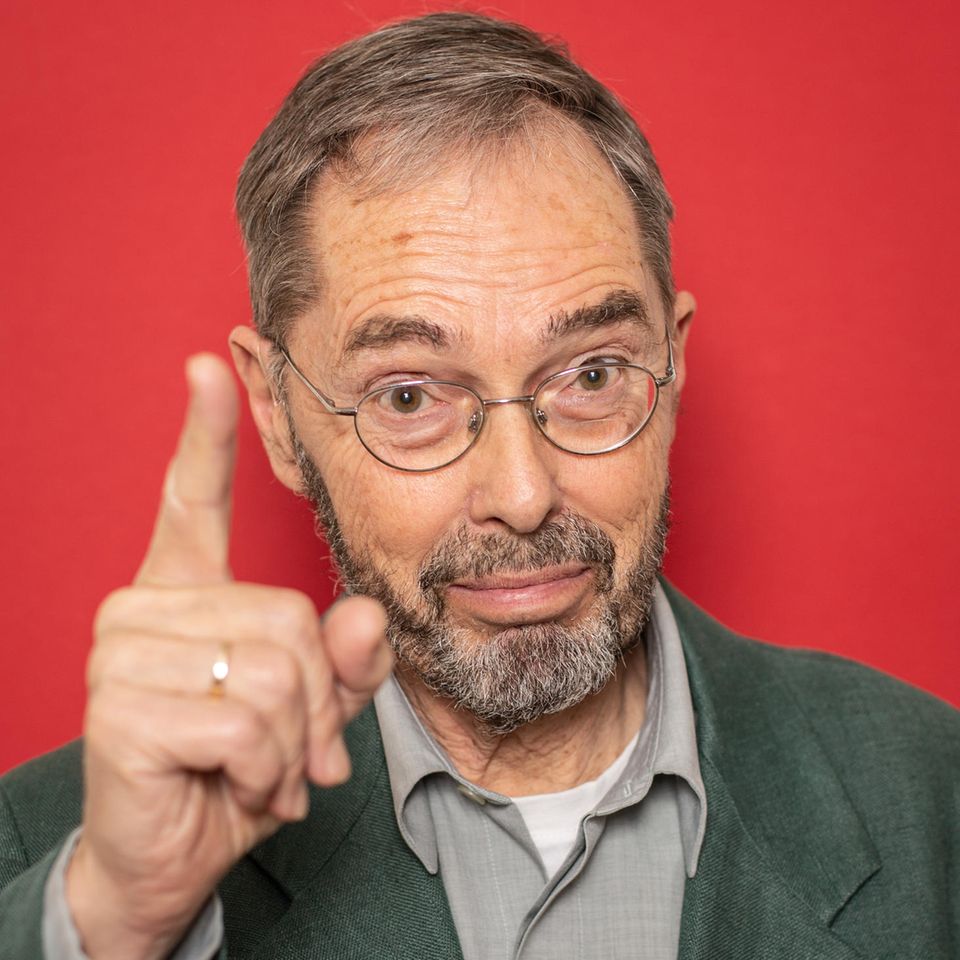Ein Stück Torte zu viel gegessen, die Freunde wieder nicht angerufen, ein Terminversprechen auf der Arbeit nicht eingehalten, im Streit unfaire Dinge gesagt – die Gründe für ein schlechtes Gewissen können vielfältig sein. Doch woher kommt dieses Gefühl, das sich unangenehm im Magen breit macht, zu Kopfschmerzen und sogar zu Depressionen führen kann?
Die gute Nachricht vorweg: Ein schlechtes Gewissen ist steuerbar und nicht immer von Nachteil. Auch, wenn es sich zugegebenermaßen alles andere als gut anfühlt.
Schlechtes Gewissen abhängig von Gedanken
Das Gewissen ist kein Teil des Körpers oder speziell des Gehirns. Es ist ein Teil der Gesellschaft, der Erziehung, des eigenen Selbstverständnisses und damit auch des Selbstbewusstseins. Während es Menschen gibt, die ihr eigenes Verhalten niemals in Frage stellen, gibt es andere Menschen, die sich täglich und dauerhaft mit ihrem Tun und ihrem Gewissen beschäftigen – dem Widerspruch zwischen dem eigenen Verhalten und der persönlichen Wertvorstellung.
Das Gewissen stellt das eigene Verhalten in Frage
Das Gewissen ist eine Art emotionaler und auch moralischer Kompass, der uns sagt, ob wir etwas richtig oder falsch gemacht haben. Also praktisch eine innere Stimme, mit deren Hilfe wir Entscheidungen, Antworten, unser gesamtes Handeln reflektieren, bewerten und gegebenenfalls zukünftig ändern können – wenn wir es denn wollen. Und damit erscheint ein ganz wesentlicher Punkt auf der Gewissensbühne.
Offenbar ist das schlechte Gewissen – und auch die Frage, ob es bei manchen Menschen überhaupt vorhanden ist – von vielen Faktoren abhängig. Das kann anerzogener Perfektionismus ebenso sein wie ein hoher moralischer Anspruch oder ein geringes Selbstwertgefühl. Andere Menschen machen uns zum Beispiel ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, wenn sie uns etwas vorwerfen und wir damit nicht umgehen können.
Fehler anderer Menschen schlecht werten und sich besser fühlen
Auf den Punkt gebracht, ist ein schlechtes Gewissen ein Schuldgefühl, das in der Intensität und Ausprägung von der Persönlichkeit der jeweiligen Person abhängig ist. So kommt eine Studie der israelischen Universität Ben-Gurion zu dem Schluss, dass Menschen, die an ihre eigenen Fehltritte erinnert werden und sich noch einmal damit auseinandersetzen müssen, die vergleichbaren Fehltritte bei anderen Menschen wesentlich strenger beurteilen.
Das Ergebnis: Diese Person distanziert sich gleich doppelt von ihren eigenen Fehltritten und erhält so ein positives Selbstbild.
Schlechtes Gewissen beinhaltet Schuld und Scham
Das Gewissen und damit auch das schlechte Gewissen ist also höchst variabel. Trotzdem ist das Für und Wider, das Abwägen, Schuld geben und Vergeben ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft, denn Moral ist kein Naturgesetz. Moral basiert auf den aktuell gültigen Werten einer Gesellschaft und setzt somit auch die Grenzen für „Gut“ und „Schlecht“.
Wer einer bestimmten Gruppe zugehörig sein will, stellt somit sein Verhalten im Sinne des Gewissens in Frage. Das kann eine Partnerschaft ebenso sein, wie ein Kegelverein, eine Partei, Kirchengemeinde, Nachbarschaft oder Dorf- oder Wohngemeinschaft. Auch Religion vermittelt Gewissen: Du sollst nicht stehlen. Sage ich der Kassiererin im Supermarkt, dass sie mir zwei Euro zu viel rausgegeben hat oder nicht? Und wie fühle ich mich, abhängig von meiner Entscheidung?
Großes Selbstbewusstsein schützt vor dem schlechten Gewissen
Das Gewissen ist also beeinflussbar und somit auch das schlechte Gewissen. Wichtig ist zum Beispiel, immer ein positives Bild von sich selbst zu haben. Das grenzt die Möglichkeiten und das Ausmaß eines schlechten Gewissens ein. Klingelt dennoch mal die Alarmglocke im Gewissen, dann gibt es verschiedene Mittel und Wege, dass schlechte Gewissen wieder loszuwerden. Ein paar Tipps:
- Akzeptieren Sie Ihre Fehler – verlangen Sie nicht zu viel von sich.
- Machen Sie nicht alles selbst – geben Sie Verantwortung und damit die Kontrolle ab. Das erleichtert ungemein und Sie müssen auch nicht immer erreichbar sein.
- Hinterfragen Sie Ihr schlechtes Gewissen. Selbstkritik ist gut, aber zu viel davon kann ungesund werden. Lassen Sie sich von Ihrem schlechten Gewissen nicht tyrannisieren. Sie entscheiden, wann es gut ist. Treffen Sie Entscheidungen nicht aus dem schlechten Gewissen heraus, sondern weil Sie es wollen.
- Warten Sie ab, bevor Sie handeln. Oft zeigt sich erst mit der Zeit, ob Sie wirklich ein gravierendes Fehlverhalten an den Tag gelegt haben und zum Beispiel mit jemandem klärend sprechen müssen.
- Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart – genießen Sie den Augenblick und beschäftigen Sie sich mit schönen Dingen, statt mit Ihrem schlechten Gewissen und der Vergangenheit. Eine emotionale Auszeit in den Gedanken bringt den Gewissenskompass oft wieder in die richtige Richtung.
- Denken Sie an sich selbst! Wenn Sie ständig an andere Menschen denken, vergessen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse. Mit wem und womit will ich meinen Tag verbringen? Wer stellt Ansprüche an mich, die ich nur aus einem Schuldgefühl heraus erfülle? Auch Pflichten können in die Warteschleife, wenn sie nicht weglaufen und später erledigt werden können. Nichts ist so wichtig wie Sie selbst – gönnen Sie sich gesunden Egoismus.
- Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein! Je mehr Sie davon haben, desto größer die Hürde für das schlechte Gewissen. Selbstbewusste Menschen akzeptieren ihre Fehler besser, haben keine Scham ein Missgeschick zuzugeben, sind entscheidungsfreudiger, fühlen sich leichter.
Fehler eingestehen für die persönliche Entwicklung
Dabei sind Gewissensbisse aber nicht nur schlecht. Wer ein schlechtes Gewissen hat, denkt über sein eigenes Handeln nach. Das hat zur Folge, dass das Verhalten korrigiert werden kann und damit gleichzeitig eine persönliche Entwicklung stattfindet. Wer stattdessen immer alles richtig macht, braucht schließlich die Stufe auf seiner persönlichen Leiter nicht zu verlassen und bleibt einfach dort stehen, wo er ist.
Torte statt Selbstvorwürfe
Dominiert aber das schlechte Gewissen den Alltag, empfinden Menschen ihr Leben weniger lebenswert als die Menschen, die ihr Handeln seltener in Frage stellen. Die Angst, den eigenen Erwartungen und den Erwartungen des Umfeldes nicht gerecht zu werden, kann in eine ausgeprägte Opferrolle, Selbstvorwürfe und bis zur Depression führen.
Die Lösung: die eigenen Werte überprüfen, was ist einem selber wichtig fürs Leben, das persönliche Glück voranstellen und ab und zu mit Hochgenuss ein dickes Stück Torte essen.