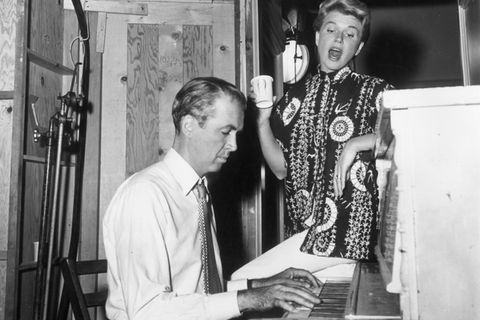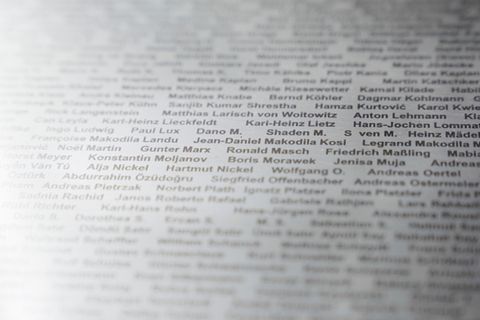Jugendliche werden immer wieder aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Orientierung von Gleichaltrigen drangsaliert. Bei "physischem Mobbing" werden Betroffene von Mitschüler*innen etwa geschlagen, getreten oder geschubst. Bei "verbalem Mobbing" versuchen Täter*innen, die Opfer mithilfe von Beschimpfungen wie "Schwuchtel" oder "Tunte" oder durch Drohungen zu demütigen. Wer gemobbt wird, flüchtet oft in Einsamkeit und Isolation. Oder tut so, als seien die Attacken egal – damit die anderen nicht merken, wie groß die Verletzung tatsächlich ist. Während physisches oder verbales Mobbing in der Schule oder auf dem Nachhauseweg stattfindet, sind Betroffene von Cybermobbing nicht einmal daheim sicher: Die Attacken finden in der digitalen Welt statt. Täter*innen veröffentlichen Fotos oder Gerüchte, etwa in geschlossenen Chatgruppen oder öffentlich im Internet.
Wo bekommen Betroffene Hilfe?
In Schulen sollte die erste Anlaufstelle das Lehrpersonal sein. In Deutschland können sich Betroffene an verschiedene Hilfestellen wenden. Die "Nummer gegen Kummer" etwa ist unter 116 111 zu erreichen. Es gibt auch online Hilfe per Chat, der von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung angeboten wird. Weitere Anlaufstellen sind etwa das Beratungsprojekt "Juuuport", die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder das Krisen- und Informationstelefon "Rosa Strippe", erreichbar unter 0234-19446. In Österreich können Betroffene die gebührenfreie Nummer 0800 700 144 wählen, um mit ausgebildeten Helfenden vom Jugendrotkreuz zu sprechen. In der Schweiz findet sich auf der Website mobbing-zentrale.ch/anlaufstellen Hilfe, je nach Kanton gibt es eine andere Anlaufstelle. Hilfreich für die Aufarbeitung des Geschehens kann es außerdem sein, wenn Betroffene ein Tagebuch führen, in dem sie dokumentieren, wann von wem welche Art von Angriff ausgegangen ist. Dazu gehört auch etwa, Screenshots von Attacken in Social Media zu archivieren.
Was können Lehrer*innen tun?
Lehrkräfte haben die gesetzlich verankerte Pflicht, sich gegen homo- oder trans*feindliches Verhalten zu positionieren. Allerdings sollten sie nicht allein gegen Mobbing vorgehen, sondern mit anderen Expert*innen, etwa Schulpsycholog*innen. Denn es ist wichtig, dass man mit Opfern, Täter*innen und Beteiligten aus unterschiedlichen Perspektiven sprechen kann. Als Lehrperson gilt es, sich immer wieder und unmissverständlich zu positionieren: Homo- und Trans*feindlichkeit wird nicht geduldet. Allerdings sollte niemand ohne das Einverständnis des Opfers gegen das Mobbing vorgehen. Zeitgleich gilt es, sie oder ihn dazu zu motivieren, weitere Übergriffe zu melden. Wichtig ist daher, zu allererst das vertrauliche Gespräch mit dem Opfer zu suchen, um auf dessen Bedürfnisse eingehen zu können. Als wirksam zur Prävention haben sich auch "Klassentage gegen Mobbing" oder Informationstage zu Diversität und LGBTQIA+ erwiesen, an denen Schüler*innen mit verschiedenen Trainingsaufgaben und Rollenspielen für das Problem sensibilisiert werden.
Was können Mitschüler*innen tun?
Neben den Täter*innen und den Opfern, so Forschende, gibt es in einer Klasse üblicherweise drei weitere Gruppen von Beteiligten: Rund ein Viertel der Schüler*innen unterstützen die Täter*innen zwar nicht aktiv, verstärken aber deren Verhalten. Sie lachen beispielsweise, wenn es zu Attacken kommt, oder feuern die Peinigenden an. Viele andere sind Zuschauende, die Mobbing ablehnen, aber dennoch nicht einschreiten, weil sie die Übergriffe nicht richtig einschätzen oder Angst haben. Und eine Minderheit schließlich, so es sie denn in einer Klasse überhaupt gibt, versucht sich auf die Seite der Opfer zu stellen, zu trösten oder die Täter*innen von weiteren Attacken abzuhalten. Auch hier gilt: Niemand sollte sich allein gegen Mobbing stellen. Wenn erst einmal die Mehrheit der Mitschüler*innen Partei für die Betroffenen ergreift, erkennt die mobbende Person schnell, dass ihre Attacken nicht erwünscht sind.
Was können Eltern tun?
Erfahren Eltern, dass ihr Kind gemobbt wird, sollten sie möglichst vermeiden, zu massiv zu reagieren – so schwer dies auch fallen mag. Wer etwa die Eltern der Täter*innen unter Druck setzt oder Lehrpersonen dazu auffordert, pauschal Strafen zu verhängen, trägt nicht zur Verbesserung der Situation für das Opfer bei. Vor allem im Umgang mit der Schule kann sich eine womöglich noch dramatisierende Darstellung von Übergriffen sogar schädlich auswirken. Schließlich müssen sich die Lehrer*innen ein objektives Bild von der Lage verschaffen können, um realistisch einzuschätzen, welche Gegenmaßnahmen wirksam sind. Expert*innen, die untersuchen, wie sich die Attacken wirksam bekämpfen lassen, haben festgestellt: Eher als den Eltern kommt den Lehrer*innen eine Schlüsselrolle zu. Achten diese sensibel auf Warnzeichen (etwa, dass eine Schüler*in plötzlich in sich gekehrt wirkt) und schreiten rechtzeitig ein – können sie gemeinsam mit den Eltern wirksam dagegen vorgehen.
Dieser Text erschien zuerst im aktuellen GEO Wissen Extra Heft zum Thema Sexuelle Vielfalt und Identität. Hier bestellen