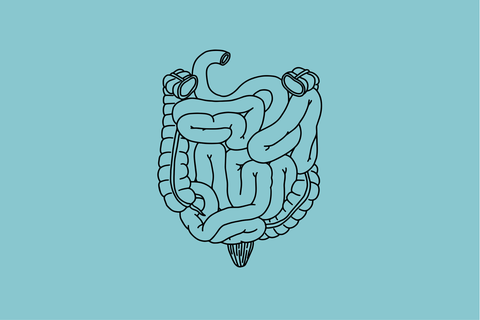Vor allem ist da diese riesige Trauer, die nicht abnimmt, sondern immer noch wächst. „Für andere Gefühle ist in meinem Herzen fast kein Platz mehr“, sagt Annie Vartivarian. Die 62-Jährige verlor am 4. August 2020 ihre Tochter. Gaia, die mit Nachnamen Fodoulian hieß wie ihr Vater, wurde nur 29 Jahre alt. Sie starb, als im Hafen von Beirut eine riesige Menge Ammoniumnitrat explodierte.
Vartivarian ist eine kleine Frau, etwa 1,60 Meter. Sie trägt die Haare kurz, spricht schnell aber deutlich. „Gaia wollte duschen, hatte sich schon ihr T-Shirt ausgezogen“, erinnert sie sich an die Katastrophe, „doch dann kam sie zu mir ins Wohnzimmer gerannt, um zu sehen, was los ist.“ Hangar 12, wo die Chemikalien lagerten, war vielleicht 900 Meter entfernt von ihrer Wohnung im zehnten Stock eines modernen Apartmentgebäudes im Stadtteil Ashrafiyye. Gemeinsam standen Mutter und Tochter vor der acht Meter breiten Fensterfront und sahen den Rauch aufsteigen über dem Hafen.

Galeristin Annie Vartivarian im Tabbal-Gebäude im Stadtteil Sursock, wo die Eröffnungsausstellung der „Art Design Lebanon“ stattfand
„Es wurde größer und größer, lauter und lauter“, sagt Vartivarian. Während die Chemikalien explodierten, hörten die beiden Frauen schon die ersten Fenster zerbersten, ein blitzschnell ansteigendes Krachen. Immer weitere Teile Beiruts wurden von der Druckwelle überspült. „Lauf, Gaia“, schrie Annie Vartivarian, bog links herum und floh in den Flur vor der Küche. Ihre Tochter hatte sich in die andere Richtung gedreht. Wenige Augenblicke später fand sie Gaia regungslos auf dem Boden liegen. Und die halbe Stadt lag in Trümmern.
Fast fünf Milliarden Dollar Sachschaden
Bei der Explosion wurden laut Angaben von Human Rights Watch 218 Menschen getötet und etwa 7000 verletzt. 77.000 Wohnungen wurden verwüstet, 300.000 Menschen obdachlos. Allein der materielle Schaden belief sich laut Weltbank auf 3,8 bis 4,6 Milliarden Dollar. Fast sechs Jahre lang hatte das Ammoniumnitrat in Hangar 12 in unmittelbarer Nähe des dicht besiedelten Zentrums gelagert. Immer wieder hatte es Warnungen an Sicherheitsbehörden und Politiker gegeben. Zwei Wochen vor der Katastrophe waren wohl auch Premier Hassan Diab und Staatspräsident Michel Aoun über die tickende Zeitbombe im Bilde. Aber nichts passierte, wie so oft im Libanon.
„Die Regierung wird einen Weg finden, um ihre Verantwortung zu verschleiern“, ist sich Annie Vartivarian sicher. Seit der Apokalypse trägt sie nur noch schwarz. „Nicht bewusst, sondern weil mir nach Farben einfach nicht mehr der Sinn steht“, sagt sie. Die offizielle Untersuchung hat noch immer keine Ergebnisse geliefert. Ein erster Ermittlungsrichter wurde abberufen, weil er die Befragung des Premiers und mehrerer Minister angestrebt hatte. Die Politiker verweigerten sich, ein Gericht entzog ihm das Mandat.
Auch die Bemühungen des Nachfolgers werden systematisch blockiert. Zuletzt unterzeichneten mehr als 30 Abgeordnete einen Antrag, um eine separate Ermittlungskommission des Parlaments zu bilden – und die Justiz zu entmachten. „Es ist meine Pflicht darüber zu sprechen, was passiert ist“, sagt Annie Vartivarian, „für Gaia, für die Opfer, für den ganzen Libanon.“ Und Gaias zwei Jahre ältere Schwester Marianna Fodoulian, Vorsitzende der Hinterbliebenenvereinigung, sagt: „Von der Untersuchung hängt ab, ob wir in diesem Land eine Zukunft haben.“
Die Landeswährung hat 90 Prozent an Wert verloren
Der Libanon war bereits 2019 in eine schwere Krise gerutscht. Damals war das Finanzsystem, das auf hohen Profiten für die Banken und immer schwindelerregenderen Staatsschulden basierte, kollabiert. Seitdem hat das Libanesische Pfund 90 Prozent seines Werts verloren – und die meisten Bürger damit die größten Teile ihres Einkommens und Vermögens.
Die Hälfte der Bevölkerung ist, als Folge der Inflation, in die Armut gestürzt. Treibstoff ist knapp, vor Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Es gibt kaum noch Strom, nachts liegt Beirut im Dunkeln. Die UN warnt, dass vier Millionen Menschen bald das Leitungswasser ausgehen könnte, weil immer weitere Pumpen ausfallen. Die meisten Medikamente sind nicht mehr erhältlich. Laut Weltbank zählt die Krise im Libanon zu einer schwersten seit dem 19. Jahrhundert.
Beirut ein Jahr nach der Explosion: Bilder einer Stadt in Trümmern

Beirut ein Jahr nach der Explosion: Bilder einer Stadt in Trümmern
Kinder spielen in den Trümmern, dahinter die Ruine des am 4. August 2020 zerstörten Getreidesilos im Hafen
Was ist aus dem Land geworden, das einmal als Schweiz des Nahen Ostens galt, mit einer Hauptstadt, in der sich die Patrizier in den vergangenen Jahrhunderten prunkvolle Wohnpaläste und Museen gebaut hatten? Der 15-jährige Bürgerkrieg hat nicht nur weite Teile der Kapitale, sondern auch die Struktur der Gesellschaft zerstört. Der Friedensschluss brachte keine Aussöhnung, sondern nur eine neue Aufteilung der Pfründe und Posten – nicht nach Leistung, sondern nach Proporz. 18 konfessionelle Gruppen beherrschen das Land, viele von ihnen werden von ehemaligen Warlords angeführt. Ein besonders mächtiger und gefährlicher Player in diesem Ränkespiel ist die schiitische Hisbollah-Miliz.
„Wir haben keine echte Demokratie, sondern ein System der charismatischen Führer“, sagt Nizar Saghieh, Rechtsanwalt und Gründer der NGO Legal Agenda. Es sei auch ein System der Straflosigkeit, weil Verantwortung stets von einem zum anderen Politiker oder Behördenchef geschoben werden könne. Der Staat diene als Beute. Wohl nirgends war das mehr der Fall als im Beiruter Hafen, an dem sich die Partei-Milizen über Jahrzehnte besonders schamlos bereicherten. Deshalb ist die Klärung der Schuld für die Explosionskatastrophe so schwierig.
Ganze Häuserblocks stehen leer
Auf eine Entschuldigung oder wenigstens einen Ausdruck des Bedauerns vonseiten des Staates warten die Opfer und Hinterbliebenen bis heute vergeblich. Auch beim Wiederaufbau waren die Institutionen kaum präsent. Einzig an der Aufteilung der zerstörten Viertel in Operationsgebiete beteiligte sich die Armee. Die eigentliche Arbeit übernahm die Zivilgesellschaft. Aber viele Geschäfte, Restaurants und Bars haben nach dem 4. August nicht wiedereröffnet, ganze Häuserblocks stehen bis heute leer. Dass überhaupt wieder Leben eingekehrt ist in die verwüsteten Straßen, ist dem Einsatz internationaler und nationaler NGOs zu verdanken.
Eine wichtige Rolle dabei spielt die Beirut Heritage Initiative. Dort dokumentiert die junge Architektin Yasmine Dagher permanent den Fortschritt der Aufbauarbeiten. In den direkt am Hafen liegenden Vierteln verzeichnet ihre Organisation immerhin 30 Prozent abgeschlossene und neun Prozent laufende Renovierungen historisch wertvoller Bauten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Diese seien besonders wichtig für die Stadt: „Wenn wir diese Gebäude erhalten können, erhalten wir auch die Bewohnerschaft – und damit das Gefüge ganzer Viertel“, so Dagher. „Wenn das architektonische Erbe verschwinden würde, würden wir unsere Kultur und unsere Identität verlieren. Unsere Stadt hätte dann keine Stadtgeschichte mehr.“ Das bauliche Erbe Beiruts gilt als einzigartig: Viele Prunkbauten und Stadtvillen stammen aus der osmanischen Zeit und der französischen Mandatszeit, nach der Unabhängigkeit kamen bedeutende moderne Gebäude hinzu.
Ein Assad-Freund wird Premier
Nicht auszudenken, was aus der libanesischen Hauptstadt geworden wäre, wenn, wie zunächst angenommen, 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert wären. Laut einer FBI-Untersuchung waren es aber lediglich 552 Tonnen, also nicht mal ein Fünftel der Menge, die im November 2013 ein Schiff aus Georgien unter dubiosen Umständen in den Beiruter Hafen gebracht hatte. Wo der Rest verblieben ist? Auch das ist unklar. Regierungschef damals war Nadschib Mikati. Ausgerechnet der Milliardär aus Tripoli, ein erklärter Freund von Syriens Diktator Baschar al-Assad, soll nun wieder Premierminister werden.
Die Europäische Union beschloss Ende Juli ein Sanktionsregime für den Libanon. Vielleicht erzeugt die Androhung von Strafen endlich den nötigen Druck, Reformen umzusetzen. Alle Appelle und Aufforderungen waren bisher vergeblich. Der einfachen Bevölkerung aber werden Sanktionen wohl kaum helfen. Ein Jahr nach der verheerenden Explosion ist ihr Leben härter denn je. Und Mütter wie Annie Vartivarian trauern weiter um ihre Kinder.
Hilfsprojekt "Stones of Beirut"
Wer mehr über Annie Vartivarian erfahren will, kann das Projekt "Stones of Beirut" verfolgen – eine multimediale Spendenkampagne, die ein Zeichen gegen das Vergessen der Katastrophe von Beirut setzen möchte.