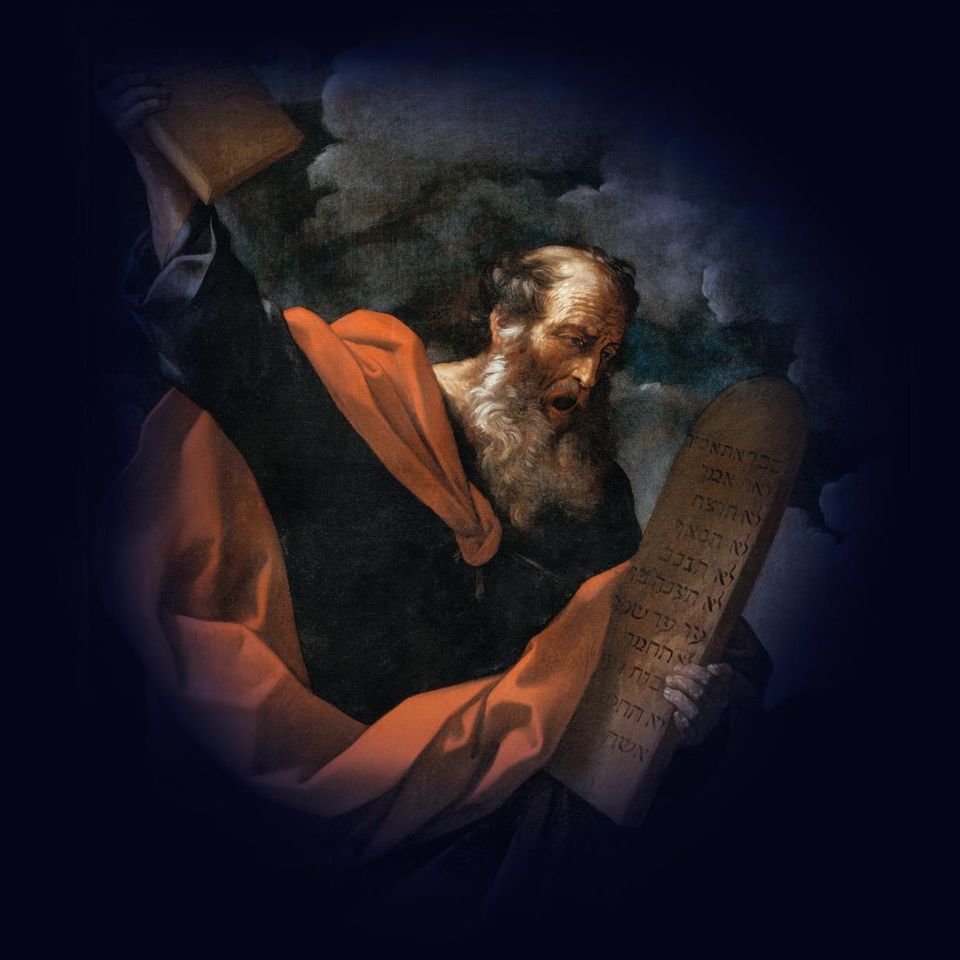Jerusalem, 2. April des Jahres 30. Was für ein Gedränge in den Gassen und auf den Plätzen, was für eine Ausgelassenheit rund um den heiligen Ort der Juden: den Tempelberg. Rund 40.000 Menschen leben hier. Doch heute sind fast viermal so viele in der Stadt: Pilger. Das Passahfest naht, eine der wichtigsten Feiern im Jahr.
Da beobachten einige Soldaten einen Mann, der mit einer Anhängerschar über den Ölberg kommt und in die heilige Stadt einzieht – einen Mann, den sie hier nie zuvor gesehen haben.
Der Pilger heißt Jesus von Nazareth. Und er hat nur noch 120 Stunden zu leben.
Seit rund 300 Jahren bemühen sich Wissenschaftler, einen Blick auf den "wahren", den historischen Jesus zu werfen. Historiker und Theologen, Philologen und Archäologen haben aus verstreuten Funden und wiederentdeckten Texten, aus Mauerresten, Münzen, Inschriften und Gefäßen ein faszinierendes Puzzle zusammengefügt.
Was treibt Jesus hinaus aus seiner Vaterstadt Nazareth?
Viele selbst ernannte Propheten, Wundertäter und Magier ziehen zu Lebzeiten Christi in Judäa und Galiläa umher. Sie wähnen sich am Vorabend der Apokalypse. Es wird, glauben sie, bald den Endkampf geben, die finale Schlacht Gottes gegen das Böse, die mit der Befreiung Israels gekrönt werden wird. Einer von ihnen: Jesus aus Nazareth.
Was aber ist das Ungewöhnliche an seiner Biografie? Was formt Jesus, was treibt ihn hinaus aus seiner Vaterstadt, bringt ihn dazu, sich den Unreinen, den Zöllnern und Prostituierten zuzuwenden? Die Althistoriker werden wohl niemals erfahren, weshalb Jesus damals Nazareth den Rücken kehrte. Einigermaßen sicher ist nur, dass Jesus, wohl im Jahr 28 oder 29, etwas Unerhörtes tut: Er verlässt seine Familie.
Und im Frühjahr 29 verkündet in Galiläa ein neuer Prediger seine Botschaft.
Unter den Anhängern hebt Jesus zwölf Männer heraus: die Apostel
Bergpredigt, Gleichnisse, Wunder – was um Jesus danach geschieht, gehört zum überlieferten Kanon des Abendlandes. Doch die Evangelisten bleiben in ihren Beschreibungen vage. Seriös zu rekonstruieren ist Folgendes: Jesus predigt wohl nur etwa ein Jahr lang. Er zieht durch einen Teil Galiläas, hier erzählt er die Gleichnisse; hier gewinnt er seine Anhängerschaft.
Jesus ist also von seiner Herkunft, der Dauer seines Wirkens und dem Ort seines Auftretens her in jeder Hinsicht eine Randfigur. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die annähernd zeitgenössischen heidnischen Autoren, dass Roms Politiker und Schreiber so wenig über ihn berichten.
Dass sich ihm Menschen tatsächlich bedingungslos ergeben, ist sehr wahrscheinlich. Schließlich werden einige von ihnen noch Jahrzehnte nach der Kreuzigung in seinem Namen in den Tod gehen, etwa Petrus. Wird sich die Botschaft Jesu nicht zuletzt wegen des Beispiels, welches die frühen Christen mit ihrem Märtyrertum geben, so schnell im Römischen Weltreich verbreiten.
Unter den Anhängern hebt Jesus zwölf Männer heraus, die Apostel – in Anspielung auf die symbolische Dutzendzahl, etwa auf die legendären zwölf Stämme des Volkes Israel. Aber diese Zahlensymbolik ist nicht ungewöhnlich. Außergewöhnlich dagegen ist, dass Jesus auch viele Frauen folgen. Die Gesellschaft ist patriarchalisch: Frauen dürfen nicht aus der Tora lesen, im Jerusalemer Tempel ist ihnen nur ein Hof reserviert; sie dürfen nicht als Zeugen vor Gericht aussagen. Doch alle Evangelisten heben hervor, dass die Frauen zu den eifrigsten Gefolgsleuten Jesu gehören. Maria aus Magdala, einer Stadt auf halbem Weg zwischen Nazareth und Kapernaum, wird die bekannteste unter ihnen.
Für die Bauern, Hirten und Fischer müssen dieser Mann und seine Anhänger beunruhigend fremd und dabei doch seltsam vertraut wirken: fremd, da die Gruppe brotloser Menschen von Almosen lebt und ohne Wanderstock herumzieht, denn so ein Stecken könnte als Waffe gedeutet werden und damit das Liebesgebot verletzen. Vertraut, weil in so einem kleinen Land wohl jedermann Jesus oder einen seiner Getreuen kennt. Propheten wie er sind ohnehin keine aufsehenerregende Erscheinung zu jener Zeit; Jesus ist ja nur einer von vielen, die herumziehen und predigen.
Der Mann aus Nazareth gibt sich allerdings umstürzlerisch. Die Schmähung der Reichen – "Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme!" –bleibt nicht die einzige Äußerung dieser Art. Mit seiner Missachtung des Reichtums provoziert er die Eliten seiner Zeit, die Großgrundbesitzer, die Adligen, die Priester.

Und nicht nur die. Bestrafung des Ehebruchs, eines, zumindest bei der Frau, todeswürdigen Verbrechens? "Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie."
Diese Geringschätzung der Tradition kann als Aufforderung zum Umsturz verstanden werden. Sie widerspricht jedenfalls dem religiösen Verständnis der Mehrheit des jüdischen Volkes.
Jesus ist Jude, seine Anhänger sind Juden. Er predigt vor Juden. Und fordert dennoch, auf vieles von dem zu verzichten, was seit Jahrhunderten das Judentum ausmacht.
Jesus fasst den Entschluss zum Passahfest nach Jerusalem zu ziehen
Dass er aber beansprucht, der "Messias" zu sein – jener "Gesalbte", der das Volk Israel zum Heil führen wird –, das ist die größte Provokation: Damit wäre Jesus die oberste Autorität des Judentums. Das werden die Priester nicht gern vernommen haben, deren Position er infrage stellt. Und die Römer schon gar nicht, die den Volksaufstand fürchten. Dass Jesus zunächst nicht verfolgt wird, mag daran liegen, dass sich sein Wirken auf Galiläa beschränkt. Oder daran, dass er so erfolglos ist. Manches deutet darauf hin, dass er nach etwa einem Jahr an einem toten Punkt angekommen ist. Er zieht, begleitet von einer vielleicht zwölfköpfigen Anhängerschar, durch die Orte am Ufer des Sees Genezareth und verkündet die frohe Botschaft vom heraufziehenden Reich Gottes.
Und dann?
Nichts.
Nichts hat sich geändert. Der Sabbat wird geheiligt wie eh und je; die Pharisäer legen die Schriften aus; Teile des Establishments paktieren mit dem römischen Statthalter Pontius Pilatus, der unbekümmert Hof hält in seinem Palast.
Dieser Artikel stammt aus GEO Chronik
Irgendwann im Frühjahr des Jahres 30 fasst Jesus den Entschluss, zum Passahfest nach Jerusalem zu ziehen. Vielleicht ist dies die konsequente Entwicklung seines Wirkens, von der Provinz zum Zentrum des Glaubens. Womöglich aber ist es auch die Verzweiflungstat eines Mannes, der in seiner Heimat gescheitert ist. Am 5. April 30, drei Tage nach seinem Einzug in Jerusalem, provoziert Jesus im Tempel einen Aufruhr – ausgerechnet kurz vor dem höchsten jüdischen Feiertag. Der Tempel, das ist das Allerheiligste der Juden, erbaut aus hellen, behauenen Steinen, auf einem Plateau, das sich über den Häusern Jerusalems erhebt.
Im Vorhof haben Händler und Geldwechsler ihre Stände aufgeschlagen, wahrscheinlich einfache Tische, Buden und Zelte aus ein paar Brettern und Stoffbahnen. Die Händler sind für den Tempel fast so wichtig wie die Priester. Denn nur in Jerusalem können vor Gott gültige Opfer vollzogen werden – und bei den Händlern im Hof können Lämmer und andere reine Opfertiere erworben werden. Ohne Händler keine Opfer. Ohne Opfer kein Kult.
Irgendwann an jenem 5. April steigt Jesus im Strom der Pilger auf den Tempelplatz, vermutlich umgeben von seinen Anhängern, und stößt dort Tische der Händler und Geldverleiher um. Niemand weiß, wie er dem Durcheinander aus umherirrenden Tieren, fluchenden Händlern und zornigen Pilgern entkommt.

Diese von den Evangelisten überlieferte "Reinigung" des Tem pels haben Christen später so verstanden, dass Jesus den Tempel vom profanen Mammon gesäubert habe.
Doch die Händler sind keinesfalls Vertreter weltlichen Kommerzes, sondern notwendig für den religiösen Kult. Indem Jesus sie an greift, greift er das Herz des Tempels an. Das ist keine Reinigung – das ist ein Akt der Revolte.
"Jesus von Nazareth, König der Juden"
Jesus wird plötzlich zur Gefahr für die Sadduzäer, die religiöse Elite. Sie stellen den Hohepriester; ihre Autorität gründet sich auf den Tempelkult – und auch ihr Vermögen: Die kultisch begründete Tempelsteuer bringt Geld.
Mit diesem Angriff auf die Tempelhändler besiegelt Jesus sein Schicksal – nicht etwa mit seiner Lehre, nicht mit Gleichnissen, Predigten und der Ablehnung althergebrachter Bräuche. Hätte er diese eine Provokation unterlassen, wäre Jesus vielleicht nie gekreuzigt worden – und seine Lehre, sein Wirken, seine Person wären möglicherweise längst in Vergessenheit geraten.
Jesus muss nun klar sein, dass ihm das Todesurteil droht. Im Gasthof von Bethanien nimmt er mit seinen Jüngern das letzte Mahl, schwört sie auf einen Bund ein, sagt ihnen die baldige Herrschaft Gottes voraus. Er denkt nicht einen Augenblick daran, nach Galiläa zurückzukehren und dort abzuwarten, bis sich die Aufregung in Jerusalem gelegt hat. Stattdessen geht er noch einmal in den Garten Gethsemane östlich des Tempels, um zu beten.
Dort wird er von einem Trupp der Tempelpolizei verhaftet.
Die Polizisten bringen den Gefangenen zu Kaiphas, dem Hohepriester. Ein paar Stunden später schleppt ihn die Tempelpolizei wohl zum Herodespalast am heutigen Jaffator, wo Pilatus residiert. Roms Statthalter macht kurzen Prozess. Er spricht Jesus schuldig, die Anklage lautet vermutlich auf umstürzlerische Umtriebe. Da nach führen ihn die Soldaten des Exekutionskommandos ab.
Blutüberströmt und nackt wird Jesus mit zwei weiteren Verurteilten durch die Gassen Jerusalems getrieben. Er trägt den Kreuzbalken. Eine Holztafel verkündet das Verbrechen des Delinquenten, in vier Buchstaben: INRI. Sie stehen für den höhnischen Titel Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, "Jesus von Nazareth, König der Juden".
Es ist wohl etwa neun Uhr morgens, als Jesus an das Kreuz genagelt wird. Er hält sechs Stunden durch. Es gibt Augenzeugen seines Sterbens: die Wachmannschaft auf Golgatha, vielleicht Schaulustige auf der Jerusalemer Mauer, von der aus man einen guten Blick auf die Gekreuzigten hat, und schließlich Maria Magdalena und andere Frauen aus seiner Anhängerschaft.
Gründungsmythos des Christentums
Das scheinbar Paradoxe: Hätte Jesus noch 20 Jahre lang weiter gepredigt – gut möglich, dass er heute längst vergessen wäre. Doch was jetzt, nach der Kreuzigung, geschieht, wird zum Gründungsmythos einer neuen Weltreligion.
Die Evangelien berichten, dass Joseph von Arimatäa, ein frommer Jude, bei Pontius Pilatus die Freigabe des Leichnams erbittet. Das Grab, das er für Jesus hergibt, liegt bei Golgatha. Wahrscheinlich ist es eine in den Felsen gehauene Kammer, die mit einem Stein verschlossen wird.
Hier wird Jesus ohne besondere Zeremonie beigesetzt.
Am Morgen des 9. April dann nähern sich Maria Magdalena und wahrscheinlich zwei oder drei weitere Frauen dem Grab – sie wollen den Toten mit Ölen salben. Das Grab aber ist leer.
Was ist in jenen frühen Stunden des 9. April 30 vorgefallen? Dass etwas geschehen sein muss, ist unbestritten, denn ohne die Auferstehung gäbe es keine Christenheit. Erst dieses selbst die antike Gläubigkeit sprengende Wunder ist so etwas wie der Urknall des Christentums, sein Anfang, seine Begründung und Legitimation: Jesus hat den Tod überwunden, und wer ihm folgt, dem wird dies auch gelingen. Was für eine grandiose Hoffnung!
Doch worauf beruht sie?
Haben einige Anhänger Christi den Leichnam heimlich anders wo verscharrt, um mit dem Wunder des leeren Grabes die Schmach der Kreuzigung wettzumachen? Und auch weiterhin um Gläubige werben zu können? Für Wissenschaftler bleibt das Geschehen rätselhaft. Auch sie müssen erkennen, dass viele Anhänger Jesu von dessen Auferstehung überzeugt sind – so überzeugt, dass sie dafür sogar bereit sind zu sterben.
Erst die Auferstehung macht aus ihnen Christen. Nichts, das Jesus sie gelehrt hätte, kein Wunder, das er in ihrem Beisein wirkte, kein Gleichnis überwältigt sie so wie dieses Ereignis. Als Jesus noch lebte und verhaftet wurde, da sind sie geflohen und wären vielleicht nie wieder zusammengekommen. Doch nun versammeln sie sich, organisieren sich und ziehen missionierend umher.
20 Jahre später existiert eine erste christliche Gemeinde in Rom, sind die Gläubigen aus einer Randregion des Reiches im Herzen des Imperiums angekommen.
Der Aufstieg des Christentums, er erscheint selbst wie ein Wunder: Über drei Jahrhunderte hinweg werden die Anhänger der Lehre als potenzielle Umstürzler angeschwärzt, müssen Verfolgungswellen erdulden. Doch die Bewegung wächst, unaufhaltsam, gegen alle Widerstände.
Weil die Menschen im Römischen Reich verwundert sind und ergriffen von der Nächsten- und sogar Feindesliebe dieser Christen; davon, wie sie sich selbstlos aufopfern für die Schwachen, die Kranken, die Elenden; von ihrer Standhaftigkeit und Glaubensstärke selbst im Angesicht des Todes; vom Beharren auf universeller Gleichheit, die keinen Unterschied kennt zwischen Kaiser und Knecht. Deshalb fasziniert auch eine Figur wie Jesus so sehr: Er steht bedingungslos aufseiten der Armen und Schwachen. Liebe – das ist ein neues, ein revolutionäres Programm.