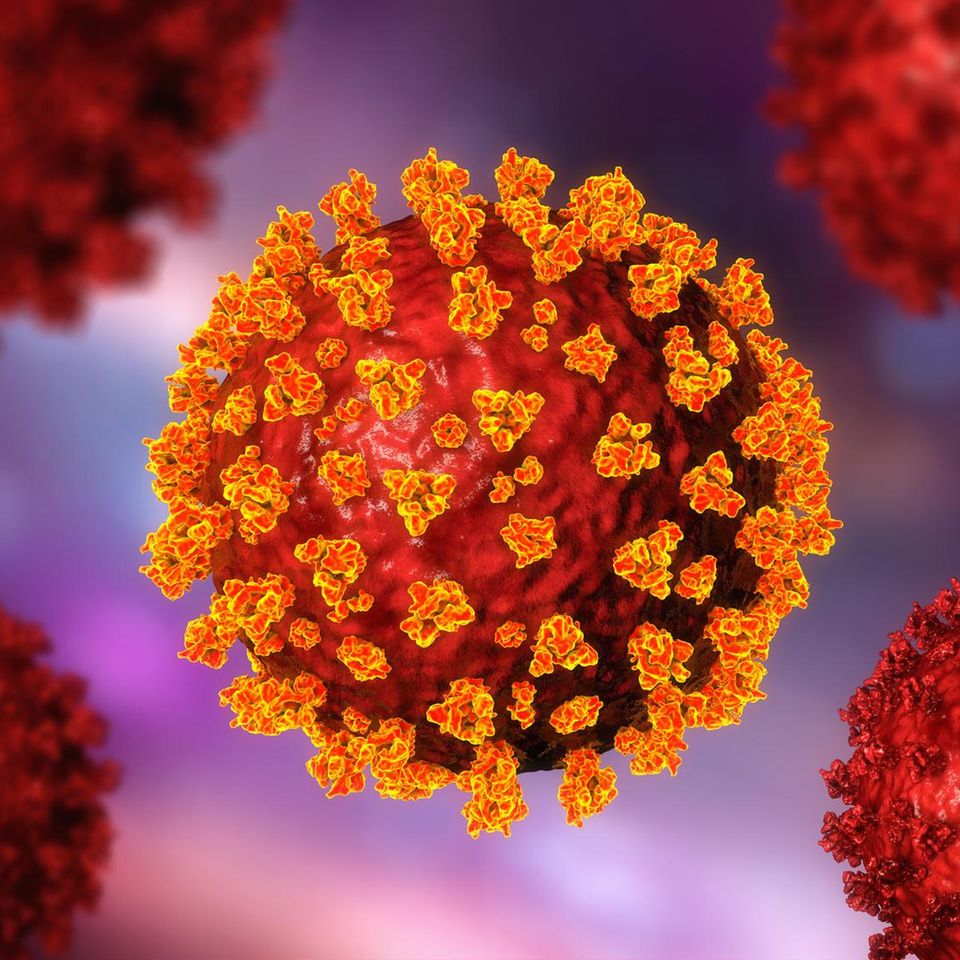Die Nutzung der mRNA-Technologie könnte sich in absehbarer Zeit über Infektionskrankheiten und die Krebsmedizin hinaus ausweiten. US-Forscher berichten im Fachblatt "Science" über den Einsatz dieses Ansatzes gegen Herzfibrose, einem weit verbreiteten Kennzeichen von Herzschwäche. Bei Mäusen besserte das Verfahren in Kombination mit der sogenannten CAR-T-Zell-Therapie demnach den Zustand geschädigter Herzen deutlich. Ein deutscher Experte spricht von einer "extrem spannenden Arbeit", allerdings sei das Vorgehen noch in einem sehr frühen Stadium.
Die CAR-T-Zell-Therapie wird erst seit wenigen Jahren in der Krebsmedizin eingesetzt, hat sich aber gegen bestimmte Leukämien und Lymphome bereits etabliert. Dort funktioniert sie folgendermaßen: Einem Patienten werden zunächst T-Zellen des Immunsystems aus dem Blut entnommen. Im Labor werden sie dann gentechnisch so verändert, dass sie auf ihrer Oberfläche einen bestimmten Rezeptor tragen: einen sogenannten Chimären Antigen-Rezeptor (CAR). Per Transfusion bekommen die Patienten dann diese CAR-T-Zellen zurück, oft nach einer Chemotherapie. Im Körper sollen die CAR-T-Zellen mit Hilfe des Rezeptors Krebszellen aufspüren und eliminieren.
Verfahren könnte bei der Herzfibrose eingesetzt werden
Das Verfahren ließe sich grundsätzlich auch bei anderen Erkrankungen nutzen, etwa bei der weit verbreiteten Herzfibrose - einem Kennzeichen einer Herzschwäche. "Herzschwäche ist die häufigste Einweisungsdiagnose für stationäre Behandlungen in Deutschland", sagt der Immunkardiologe Florian Leuschner vom Uniklinikum Heidelberg. Viele Erkrankungen können demnach in eine Herzfibrose münden - etwa Infarkte, Herzklappenfehler oder Bluthochdruck.
Dabei versuchen Bindegewebszellen - Fibroblasten -, geschädigte Herzzellen zu ersetzen. Eine übermäßige Fibroblasten-Aktivierung kann jedoch eine Versteifung des Organs verursachen. Eine gezielte Behandlung für dieses häufige Problem gibt es bisher nicht. Bei der CAR-T-Zelltherapie sollen die mit einem entsprechenden Rezeptor versehenen T-Zellen aktivierte Fibroblasten angreifen und so eine Fibrose verhindern.
Das Verfahren funktioniert zwar grundsätzlich, hat aber gravierende Nachteile: Zum einen sind Entnahme, Veränderung und Rückgabe der T-Zellen ungemein aufwendig. Vor allem aber bleiben die veränderten CAR-T-Zellen mehrere Monate bis Jahre im Körper und greifen dabei ihre Zielzellen an. In der Krebsmedizin ist das erwünscht - hier will man alle Tumorzellen ausschalten. Doch bei Fibroblasten, die für Wundheilung notwendig sind, will man das vermeiden.
Den Einsatz ermöglichen könnte die Kombination des Verfahrens mit der mRNA-Technologie, die auch bei Covid-19-Impfungen eingesetzt wird. Damit wird der Bauplan für einen gewünschten Rezeptor zu den T-Zellen gebracht. Diese bilden ihn dann selbst im Körper - ohne dass sie eigens entnommen und im Labor verändert werden müssen. Und da mRNA sehr kurzlebig ist, tritt der gewünschte Effekt nur vorübergehend auf.
Bei Versuchen an Mäusen zeigten sich erste kleinere Erfolge
In einem Machbarkeitsnachweis testete das Team um Jonathan Epstein von der University of Pennsylvania in Philadelphia das Verfahren nun an Mäusen. Zu der Gruppe gehört auch der mRNA-Pionier Drew Weissman, der als aussichtsreicher Kandidat für einen Nobelpreis gilt.
In der Studie injizierten die Forscher Mäusen mit Herzschwäche mRNA, die den Bauplan für das Protein FAP (fibroplast activation protein) enthielt. FAP aktiviert Fibroplasten, auch beim Menschen. Verpackt wurde die mRNA wie bei den Covid-19-Impfstoffen in winzige Fettkügelchen - Lipid-Nanopartikel. Zudem wurde sie an bestimmte Antikörper gekoppelt, damit sie gezielt zu den T-Zellen des Immunsystems gelangt. Mit dem FAP-Rezeptor ausgestattet, können die T-Zellen Fibroblasten erkennen und ausschalten.
Analysen zeigten, dass die intravenöse Injektion nach 48 Stunden tatsächlich viele T-Zellen umprogrammiert hatte. Nach zwei Wochen hatte sich bei den Mäusen die Herzfibrose gebessert, Größe und Funktion des Organs waren normalisiert. Eine Woche nach der Infektion fand das Team im Rückenmark der Tiere keine Hinweise mehr auf T-Zellen, die sich gegen Fibroblasten richteten.
"Modifizierte mRNA-Therapien haben wahrscheinlich weitreichende Anwendungen", schreibt das Team. Die Schaffung veränderter T-Zellen im Organismus durch mRNA eigne sich für bestimmte Krankheiten, weil die zeitweilige Natur der produzierten CAR-T-Zellen Nebenwirkungen begrenze und eine präzise Dosierung ermögliche. Allerdings müsse man die Dosierungsstrategien noch optimieren, räumen die Forscher ein.
Studien an Menschen könnten in fünf Jahren beginnen
Gerade die Dosierbarkeit sei ein großer Schritt hin zu einer möglichen klinischen Anwendung des Verfahrens, sagt der Kardiologe Leuschner, der nicht an der Studie beteiligt war. Allerdings müssten bis dahin noch viele Fragen geklärt werden, betont er. Dazu zählen unter anderem die Prüfung der generellen Verträglichkeit, das Ausschließen überschießender Immunreaktionen und die Klärung der Frage, welche Patientengruppen dafür überhaupt in Frage kämen.
Erste Studien am Menschen könnten möglicherweise schon in den nächsten fünf Jahren beginnen, schätzt der Experte. Unabhängig von der CAR-T-Zell-Therapie geht Leuschner fest davon aus, dass mRNA-Verfahren eines Tages zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Einsatz kommen werden.
Studienleiter Epstein glaubt an eine Nutzung des Verfahrens auch bei anderen Erkrankungen: "Viele schwere Erkrankungen basieren auf Fibrose, darunter Herzschwäche, Lebererkrankungen und Nierenversagen", wird er in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. "Diese Technologie könnte sich als anpassbare und erschwingliche Art erweisen, um eine enorme medizinische Last anzugehen."
In einem "Science"-Kommentar schreiben auch Torahito Gao und Yvonne Chen von der University of California in Los Angeles, die Studie zeige die Anwendbarkeit der CAR-T-Zell-Therapie jenseits der Krebsmedizin. Zwar müsse die Toxizität des Verfahrens sorgfältig geprüft werden, aber die Studie sei ein "aufregender Schritt": "Die Arbeit bietet einen starke Begründung für die Ausweitung der Immuntherapien auf Krankheitsgruppen mit ungestilltem Behandlungsbedarf."