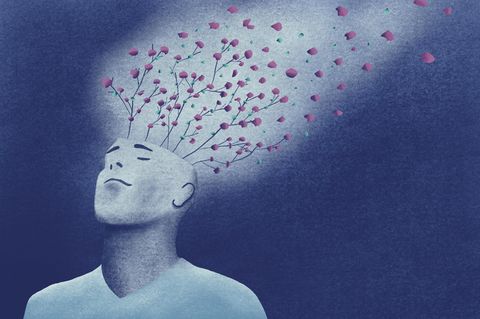Seit der dunkelbraune Sud im 17. Jahrhundert seinen Siegeszug durch Europa und die westliche Welt antrat, ist die Kaffee-Bohne zu einem der wichtigsten Handelsgüter der Welt avanciert. Um den globalen Kaffee-Durst zu stillen, werden weltweit jedes Jahr mehr als zehn Millionen Tonnen Kaffebohnen geerntet.
Doch Coffea arabica, der Kaffeestrauch, wächst weiterhin nur in bestimmten tropischen Ländern und Klimaten. Während die Pflanze ursprünglich einzeln und im Schatten großer Bäume kultiviert wurde, sind heute, um die weltweite Nachfrage zu decken, industrielle Anbaumethoden die Regel. Mit Nebenwirkungen für Mensch und Umwelt.
Mischkulturen machen den Boden fruchtbar und fördern die Artenvielfalt
Der großflächige Einsatz von Mineraldüngern und chemischen Pestiziden in riesigen Monokulturen schädigt die Böden und das Grundwasser und dezimiert die ursprüngliche Artenvielfalt.
Wer sich auch für die Folgen seines Konsums interessiert, greift darum besser zu einer umweltfreundlicheren Variante: Bio-Kaffee. Das Label der EU-Öko-Verordnung – entweder in sechseckiger Form oder mit blattförmig angeordneten weißen Sternen auf grünem Grund – schreibt vergleichsweise schonende Anbaumethoden vor. Dazu gehört:
- Monokulturen sind verboten. Die Kaffeepflanzen müssen stattdessen in Mischkultur mit anderen Nutzpflanzen, darunter Kakao, Avocado, Bananen oder Kokospalmen, angebaut werden. Das fördert die Artenvielfalt und kommt der Bodenfruchtbarkeit zugute.
- Gentechnik, mineralische Stickstoffdünger und chemisch-synthetische Pestizide und sind tabu. Vom Chemie-Verbot profitieren auch die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen. Denn die hantieren im konventionellen Anbau regelmäßig mit der Chemiespritze.
- Während im konventionellen Kaffeeanbau Erntemaschinen zum Einsatz kommen, die die Äste unterschiedslos kahlrupfen, setzt man im Bio-Anbau auf Handarbeit. Der Vorteil liegt auf der Hand: Beim manuellen Pflücken kommen nur wirklich reife Früchte in den Korb, und der Strauch wird geschont. Dieser zusätzliche Aufwand sorgt zwar für höhere Kosten, führt aber in der Regel auch zu einer besseren Auslese.
Allerdings lässt die EU-Öko-Verordnung fünf Prozent konventionelle Anteile im Bio-Produkt zu. Wer über den EU-Mindeststandard hinausgehen und beim Kaffeegenuss noch mehr für Mensch und Natur tun will, sollte also zu öko-fairem Kaffee greifen. Das zusätzliche Label eines Fairtrade-Anbieters garantiert über die EU-Öko-Standards hinaus faire Arbeitsbedingungen für die Menschen vor Ort. Weitere Label von privaten Anbauverbänden wie Bioland, Naturland oder Demeter stellen zudem höhere Anforderungen an umweltverträgliche Anbaumethoden.
Zwar ist von hundert Tassen Kaffee, die in Deutschland getrunken werden, nur jede vierte oder fünfte bio. Doch der Trend ist klar: Zwischen 2018 und 2019 stieg der Öko-Anteil am Kaffeegenuss um satte 14 Prozent.