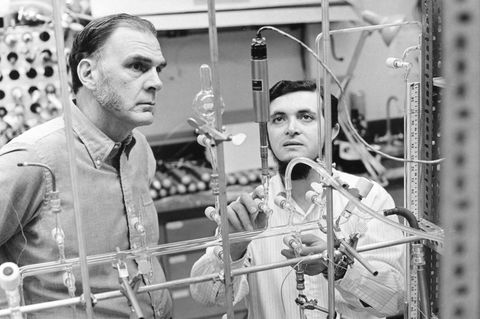Ein paar golden schimmernde Splitter, nur Millimeterbruchteile groß, geborgen vom Grund des Ozeans in fast 1000 Meter Tiefe: Bei der Analyse von Sedimentproben aus dem Amundsenmeer hat ein Wissenschaftsteam einen kostbaren Schatz entdeckt: einen Bernstein! Es ist der erste Fund von fossilem Baumharz, der bislang jemals in der Antarktis gelungen ist.
Wie das Team unter Leitung von Forschenden des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) und der TU Bergakademie Freiberg in der Fachzeitschrift "Antarctic Science" berichtet, stammen die Bernsteinfragmente aus einem Bohrkern, den die Gruppe bei einer Antarktisexpedition mit dem Forschungsschiff "Polarstern" 2017 aus der Tiefe gewonnen hatte.

"Sie erlauben einen direkten Einblick in die Umweltbedingungen der Westantarktis vor etwa 90 Millionen Jahren", sagte AWI-Meeresgeologe Johann P. Klages. Dort herrschten zu jener Zeit offenbar Klimabedingungen, unter denen harzproduzierende Bäume überlebten.
In früheren Analysen der Bohrkerne konnte Klages Team bereits Pflanzenpollen und -sporen sowie Reste von Wurzelgeflechten der Kreidezeitvegetation aufspüren – und damit rekonstruieren: Regenwälder aus Nadelhölzern und Baumfarnen, Sumpf- und Moorlandschaften überzogen damals den Südkontinent. In dieser Epoche der Dinosaurier lagen die Jahresdurchschnittstemperaturen in der Antarktis bei rund zwölf Grad Celsius, sogar nahe dem Pol.
"Der Bernstein ist nun ein weiteres Puzzlestück, das uns hilft, diesen Regenwald besser zu verstehen", sagt Henny Gerschel, die für die TU Bergakademie Freiberg an der Veröffentlichung mitgewirkt hat. In dem fossilen Harz fanden die Forschenden unter anderem Indizien dafür, dass die Bäume sehr stark mit Waldbränden und Parasiten zu kämpfen hatten.
Sind solche Erkenntnisse nun nur für Polarforschende interessant? Keineswegs! Denn die Klimadaten der Westantarktis sind ein wichtiger Faktor, um neue Rechenmodelle für die Entwicklung des Weltklimas zu erstellen. Der Blick in die Vergangenheit hilft, die Zukunft vorherzusagen. Als der Bernstein entstand, muss die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre weit höher gelegen haben, als noch bis vor Kurzem für diese Phase der Kreidezeit angenommen wurde, bei mehr als 1000 ppm. Und offenbar gab es keine größeren Landeismassen in der Antarktis, sonst hätte es den Modellen zufolge für die Entwicklung von Regenwäldern so weit im Süden nicht warm genug werden können.
Wie fest ist der jetzige Eispanzer um den Südpol?
Wenn aber die Antarktis damals so warm und eisfrei war, wie stabil sind die Gletscher dann heute? Könnten sie innerhalb weniger Jahrzehnte im Zuge des Klimawandels wieder dahinschmelzen? Verschwände der Eispanzer der Antarktis völlig, würde der Meeresspiegel um bis zu 60 Meter ansteigen – mit verheerenden Folgen für Küstenregionen weltweit. Um die Wahrscheinlichkeit einer solch desaströsen Entwicklung zu berechnen, sind Klimadaten der frühen Erdgeschichte unerlässlich.

Erst kürzlich ergab eine im Fachblatt "Nature" erschienene Studie, dass selbst die stabileren Gletscher der Ostantarktis wahrscheinlich nur so lange sicher sind, wie die Weltgemeinschaft die globale Erwärmung auf maximal zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt (wie im Paris-Abkommen vereinbart). Andernfalls, so die Autoren, drohten wir Kipppunkte zu überschreiten, die einen Eisverlust unumkehrbar machten.
Millionen von Menschenleben hängen von solchen Prognosen ab: Und so ist der Bernsteinsplitter aus der Antarktis auch eine Art Kristallkugel – für eine Zeitreise in die Erdgeschichte, aber auch für die Zukunft.