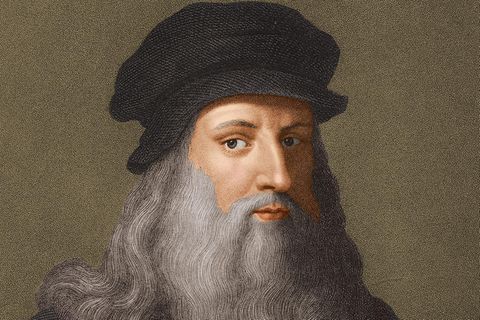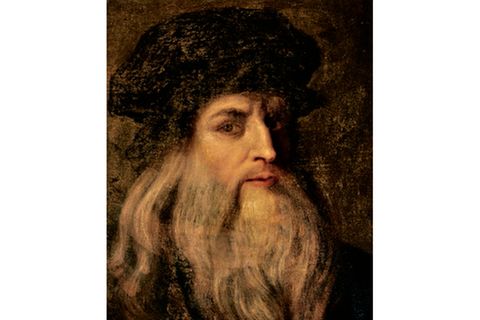Der Mann, der den Drogenrausch salonfähig macht, ist selbst ein Süchtiger. Bis zu zwölftausend Tropfen einer betörenden Opiumtinktur konsumiert er täglich, über Jahre hinweg. So manches Mal sagt er sich los von den Drogen und verfällt ihnen doch wieder. Bald fürchtet er das Einschlafen, die düsteren Visionen und Gestalten seiner opiumschwangeren Träume.
Die ersten Teile seiner autobiografischen "Bekenntnisse eines englischen Opiumessers" erscheinen anonym, doch als er 1822 seine Identität enthüllt, wird aus dem Briten Thomas De Quincey ein gefeierter Schriftsteller. Er versteht Drogen als Instrument, um verborgene Fragmente seines Ichs zu erkunden: Jegliche Erfahrungen eines Lebens, so wird er in späteren Werken schreiben, verließen das Bewusstsein nie vollständig. Sie seien lediglich unter neuen Eindrücken begraben und könnten im Opiumrausch wieder hervortreten. Die englische Leserschaft ist begeistert.
Der Rausch ist für die Künstler kein hedonistisches Vergnügen – sondern ein Portal, das herausführt aus der Welt der reinen Vernunft
Künstler in ganz Europa folgen De Quinceys Beispiel. In Paris schart der Mediziner Jacques-Joseph Moreau namhafte Kreative um sich, versorgt sie mit cannabishaltigem Konfekt und erhofft sich von ihren Beschreibungen detaillierte Einblicke in die Wirkweise der pflanzlichen Droge. Die Schriftsteller Charles Baudelaire, Théophile Gautier und Honoré de Balzac gehen ein und aus im sagenumwobenen "Club des Hachichins" – und lassen die Rauscherfahrungen in ihre epochemachenden Werke einfließen. In Deutschland preist Friedrich von Hardenberg, der sein künstlerisches Ich Novalis tauft, die tröstende und berauschende Wirkung von Opium. Ernst von Feuchtersleben dichtet wahnwitzige Verse über Haschisch.
Die drogenaffinen Schriftsteller des frühen 19. Jahrhunderts etablieren eine Art des Rauscherlebens, die an dessen spirituelle Wurzeln erinnert und in der westlichen Welt längst vergessen schien. Weder dienen Haschisch, Opium oder Absinth dem rein hedonistischen Vergnügen – enthemmte Orgien, wie sie der mittelalterliche Adel oder römische Aristokraten feierten, sind ihnen fremd. Noch nutzen sie Drogen, um das eigene Leid zu vergessen, wie es das zu weiten Teilen alkoholkranke und opiumsüchtige Proletariat ihrer Zeit praktiziert.
Die Romantiker sind vielmehr auf der verzweifelten Suche nach einem neuen, weniger entfremdeten Zugriff auf die Welt. Der Drogenrausch eröffnet, was die Rationalität der Aufklärung ihnen raubte: ein Bewusstsein für das Mystische, Gefühlvolle und Irrationale hinter den nackten Zahlen und Formeln der Vernunft. Für die Kunstschaffenden ist der Rausch keine Flucht, sondern eine bewusste Erweiterung der sonst so tristen Realität. Er wird zum Quell ihres kreativen Schaffens.
So wandelt sich der Drogenkonsum in den Kreisen der Kreativen von einem geselligen Ritual zu einer individuellen, oftmals in sich gekehrten Praxis. Kunstschaffende werden zu Leidenden, nehmen Abhängigkeit und körperlichen Verfall willentlich in Kauf, um die im Rausch gewonnenen Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen.
Viele zahlen dafür einen hohen Preis. Die Sucht kapert den freien Willen, und was als Bewusstseinserweiterung begann, wird zum Gefängnis. Auch viele Künstler der Folgegenerationen können ihr nicht entfliehen. Georg Trakl, Jimi Hendrix, Hans Fallada, Janis Joplin, Amy Winehouse: Sie alle sterben mit oder an einer hohen Drogendosis.
Trotzdem wagt im 21. Jahrhundert eine ganz neue Gruppe Kreativer den bewusstseinserweiternden Rausch: Finanzmanagerinnen, Start-up-Gründer und Firmenlenkerinnen buchen psychedelische Drogentrips mit LSD oder Zauberpilzen in cleaner Wohlfühlatmosphäre von Privatkliniken. Unter Aufsicht von "Tripsittern" erhoffen sie sich einen neuen, bislang verschlossenen Blick auf die Welt – und nicht selten eine zündende Geschäftsidee, auf die die nüchterne Konkurrenz nie kommen wird.