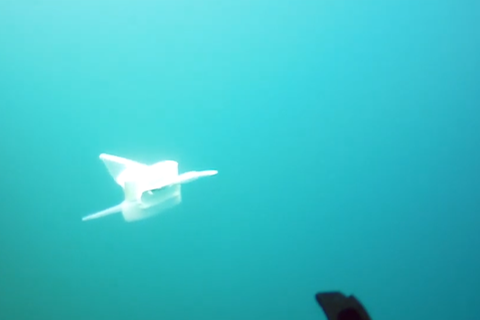Der Sinn des Lebens
Schon Aristoteles beschrieb das "Glücklichsein" als "das Ziel allen menschlichen Strebens und Sehnens". Seit Jahrtausenden wird die Frage nach dem Glück und dessen Erreichbarkeit in der Philosophie, an Stammtischen und in literarischen Ratgebern gestellt.
Doch erst in den letzten Jahren kam der Trend auf es berechnen und vergleichen zu wollen. Verschiedene Studien schwören wiederum auf verschiedene Indikatoren und Messverfahren. Allein in Deutschland findet man auf der Suche nach dem "glücklichsten" Ort diverse Antworten: Die Ergebnisse variieren von Osnabrück bis Bodensee-Oberschwaben
"Ich komm zum Glück aus Osnabrück"
Fast jedes Land und auch jede Stadt scheint in einer der vielfältigen Glücksstudien einmal an erster Stelle zu stehen. Rio de Janeiro war schon unter den glücklichsten Orten weltweit die Nummer eins (Business Magazin Forbes 2009), ebenso wie der pazifische Inselstaat Vanuatu (NEF: Happy Planet Index 2006). Der Umgang mit solch einem Titel ist sehr unterschiedlich. Beispielsweise entwickelte Osnabrück nach einer Erstplatzierung voller Stolz den Marketingslogan "Zum Glück komm ich aus Osnabrück". In Rio de Janeiro fachte die Benennung zur weltweit glücklichsten Stadt hingegen hitzige Diskussionen über die großen Ungleichheiten im Land an.
Osnabrück und Rio – wo liegen die Unterschiede in den Untersuchungen? In Deutschland rangieren im Gegensatz zu globalen Studien vornehmlich technologie- und industriestarke Regionen auf den ersten Rängen der Glücksstudien. In den Rankings der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) sowie der Immobilienzeitschrift Bellevue liegen München und Stuttgart seit Jahren an der Spitze. Außerdem lässt sich durchweg ein starkes Ost-West-Gefälle bezüglich regionaler Zufriedenheit feststellen.
Solche Ergebnisse lassen den Verdacht aufkommen, dass hierzulande im gängigen Verständnis der Wissenschaftler Glück mit dem ökonomischem Erfolg korreliert. Macht Geld doch glücklich?
Der Weg ist das Ziel
Die Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zum Glücks-BIP widerspricht dieser These. Die INSM kommt zu dem Ergebnis, dass Wirtschaftswachstum keinesfalls automatisch mehr Lebenszufriedenheit bedeutet. Das Glücklichsein scheint nach INSM ganz dem Prinzip "Der Weg ist das Ziel" zu funktionieren. Glück und Zufriedenheit hängen nicht etwa von materiellem Bestand ab, sondern vielmehr von der Tätigkeit, die diesen möglich macht.
Diese Einsicht wird durch viele global angelegte Studien wie dem Happy Planet Index untermauert, der ärmere Länder als glücklicher einstuft. Der Unterschied rührt auch aus der Wahl der relevanten Indikatoren. Der Happy Planet Index bezieht beispielsweise den ökologischen Fußabdruck einer Nation mit ein. In deutschen Untersuchungen spielt dieser bislang keine Rolle.
Bruttoinlandsglück
Jahrzehntelang wurden der Entwicklungsstand und der Erfolg von Ländern anhand von Bruttoinlandsprodukt (BIP) und anderen ökonomischen Indikatoren gemessen. Das BIP sagt allerdings nichts über das nachhaltige Wirtschaften aus, was langfristig von großem Nachteil sein kann. Weiter verrät es nichts über das Ungleichgewicht innerhalb einer Gesellschaft. Schon Robert Kennedy erkannte Ende der 1960er Jahre, dass das BIP alles misst, nur nicht das, was das Leben lohnenswert macht.
Erst in einer Gesellschaft mit postmateriellen Werten werden nunmehr andere Maßstäbe gesucht. Glücksstudien messen die Zufriedenheit der Bürger im Hinblick auf den Stand von Bildung, Kultur und Sozialem. Es wird also nicht Glück, sondern das "subjektive Wohlbefinden" ermittelt.
Glück in der Politik
Der kleine Himalaja-Staat Bhutan, maß schon in den 1970er Jahren der Bedeutung des Bruttoinlandsglücks Gewicht zu. Nun wollen Industrienationen das Glück der Bevölkerung bei politischen Entscheidungen berücksichtigen. Großbritanniens Premier David Cameron verkündete, dass die Ergebnisse einer englischen Glücksstudie zukünftig die Basis für politische Entscheidungen bilden sollen. Einer Umfrage der BBC zufolge, sind 81% der Bevölkerung der Meinung, dass die Regierung eher daran arbeiten sollte sie glücklicher als reicher zu machen. Auch die französische Regierung lässt sich von Glücksexperten wie den Nobelpreisträgern Joseph Stiglitz und Amartya Sen beraten, um sich intensiver dem Glück der Bevölkerung anzunehmen.
Die plötzliche Fokussierung der Politik ist nur konsequent. Schließlich sollte das übergeordnete Ziel politischer Entscheidungen sein, das Wohlbefinden der Bevölkerung zu steigern. Regierungen, die ausschließlich das wirtschaftliche Wachstum in den Mittelpunkt stellen, können dieses Ziel schnell aus den Augen verlieren. Sie treffen im Hinblick auf eine langfristige nachhaltige Entwicklung nicht immerzu die Glück-verträglichsten Entscheidungen. So geht beispielsweise die Förderung von langen Arbeitszeiten und ausschweifenden Konsum zu Lasten des menschlichen Wohlergehens und der ökologischen Nachhaltigkeit. Laut dem amerikanischen Forscher Med Jones kommt der Wirtschaftsaufschwung durch eine glücklichere und ausgeglichene Bevölkerung infolgedessen von ganz allein. Glücklichere Menschen sind nicht nur generell leistungsfähiger, sondern sind auch gesundheitlich durchweg in einer besseren Verfassung. Eine Entlastung des Gesundheitssystems ist nach Med Jones somit ebenfalls garantiert.
Ob und wie die Einbeziehung von Glücksmaßstäben in das politische Geschehen einen positiven Effekt auf die Bevölkerung und Wirtschaft hat oder diese überhaupt in neue Richtungen steuern kann, ist bislang nicht erforscht.
Deutschland im Glück - Hans im Glück
Im globalen Vergleich sieht es mit Deutschlands Glück nach einer von der University of Leicester durchgeführten Studie mittelmäßig aus. Deutschland ist auf Platz 35 von 178 zu finden, noch einige Plätze vor Frankreich und Großbritannien. Deutschlands Nachbarland Dänemark ist hingegen Spitzenreiter. Das Königreich Bhutan steht an 8. Stelle. Das Bruttoinlandsglück in die Politik mit einzubeziehen scheint demnach einen durchaus positiven Effekt auf die Zufriedenheit der Bhutaner zu haben.
Die emotion-Glücksstudie 2007 (Institut für Demoskopie Allensbach) verlautet allerdings Gutes für Deutschland. Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind demnach glücklich. Regionale Unterschiede gibt es jedoch auch hinsichtlich des Glücks. Norddeutsche sind demnach am glücklichsten, Ostdeutsche hatten wiederum am häufigsten eine glückliche Kindheit. Für sie sind Verreisen oder Lottogewinne von größerer Bedeutung als für den Rest der Republik. Diese Beobachtung untermauert die These, dass Menschen als Glücksfaktoren oft Dinge nennen, an denen es ihnen mangelt oder gemangelt hat.
Zudem zeigt die Untersuchung, dass sich die Haltung der Deutschen zum Sinn des Lebens in den letzten 50 Jahren stark verändert hat. Glücklichsein wird nun als eine Art Grundrecht angesehen und das Bestreben danach nicht als negativ bewerteter Egoismus abgetan.
In der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Streben nach Glück schon seit deren Unterzeichnung fest verankert. Vielleicht sollte dies auch anderen Industrienationen zum Vorbild dienen und das Recht nach dem Streben nach Glück auch im deutschen Grundgesetz verankert werden.