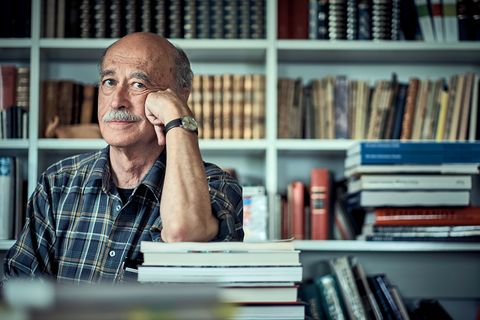Schulen und Kindergärten sind weitgehend zu, Spielplätze gesperrt und viele Eltern brauchen im Homeoffice auch mal Ruhe. Da müssen Tablet und Co. mitunter als Ersatzbetreuung herhalten. Wie problematisch ist das?
Bei vielen Familien herrscht derzeit sicher nicht die optimale Mischung aus auf den Spielplatz gehen oder mit dem Laufrad fahren und Medienkonsum. Dennoch sehe ich da vorübergehend kein Problem. Man kann davon ausgehen, dass die Kinder keinen Schaden davontragen, wenn die Eltern mal das Tablet oder den Fernseher einschalten, um weiterarbeiten zu können oder einfach etwas Ruhe zu haben. Ich glaube tatsächlich, viele Kinder finden das sogar ziemlich toll. Sie verstehen aber auch, dass es eine Ausnahmesituation ist. Sie kennen das schon von den sechs Wochen Sommerferien, in denen meistens auch viele Regeln außer Kraft gesetzt werden – zum Beispiel, dass man später ins Bett gehen darf. Und den Kindern ist klar, dass das nicht ewig so weitergeht.
Ich brauche also kein schlechtes Gewissen zu haben, dass mein Sohn heute schon mehr als eine halbe Stunde Netflix sehen durfte?
Dreißig Minuten ist die Zeitspanne, die von den meisten Quellen als Orientierung für die maximale Medienzeit pro Tag empfohlen wird. Daher kommt auch dieses geflügelte Wort „Dreißig Minuten, dann ist aber Schluss!“, das ich als Titel meines Buches gewählt habe. Ich habe mich immer gefragt: Was genau will man mit so einer Zeitbegrenzung eigentlich erreichen? Vor was soll sie schützen? Viel wichtiger ist doch zu wissen, womit sich die Kinder beschäftigen und eine sichere Umgebung zu schaffen.
Was meinen Sie damit?
Zum einen sollte man die Inhalte natürlich halbwegs kennen. Bei längeren Sendungen kann man auf Formate zurückgreifen, bei denen man darauf vertrauen kann, dass nur Dinge gezeigt werden, die dem Alter angemessen sind – wie zum Beispiel „Die Sendung mit der Maus“. Zum anderen kommt es beim Thema der sicheren Umgebung darauf an, wo das Kind die Inhalte konsumiert. Bestenfalls nimmt man den Kindern die Verlockung und die Möglichkeit von einem kindgerechten in einen gruseligen oder verstörenden Inhalt zu stolpern.
Bei Youtube landet man, wenn man sich beispielsweise für Elefanten interessiert, ganz schnell bei Elfenbein-Jägern – etwa über die Empfehlungen an der Seite oder über das Autoplay. Auch bei Apps sollte man genau hinschauen, ob dort nicht plötzlich Werbung für irgendwie Kriegsspiel auftaucht. Das ist bei manchen kostenlosen Kinder-Apps tatsächlich der Fall. Gerade bei jüngeren Kindern ist es eine Herausforderung, eine digitale Umgebung zu finden, bei der man sich überhaupt keine Sorgen machen muss. Aber am Ende kann man auch einfach auf eine DVD zurückgreifen.
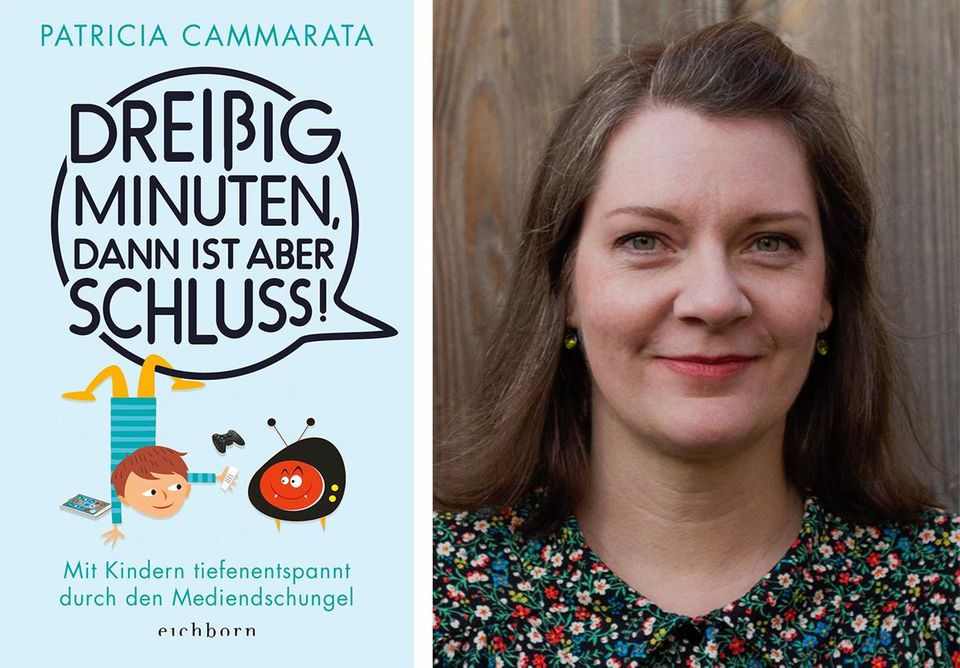
Die dann aber schnell langweilig wird...
Nein. Man muss verstehen, dass Kinder oft ganz andere Vorlieben haben als man selbst: Ständige Wiederholungen mögen uns langweilig und blöd erscheinen, doch Kleinkinder lieben sie. Ein stabiler Erwartungshorizont beruhigt sie. Viele Eltern glauben, Kinder bräuchten ständig etwas Neues. Das Gegenteil ist der Fall.
Eltern älterer Kinder werden beim Thema Youtube sicher weniger an die Unsicherheit der Umgebung denken, sondern an Schminktutorials und Youtube-Stars als problematische Vorbilder. Sie ziehen in Ihrem Buch einen interessanten Vergleich und sagen, dass die großen Kanäle inhaltlich eigentlich nichts anderes transportieren als früher Bravo und Co.
Bei denen, die Youtube selbst nicht aktiv nutzen, ist die Plattform schnell verschrien. Es heißt dann, die Inhalte seien alle total hohl, es werde ein schlechtes Körperbild vermittelt etc. – und deshalb solle man seine Kinder davon fernhalten. Wenn man aber mal die Zeitschriften seiner eignen Jugend anguckt, stellt man fest, dass genau diese Art von Entertainment schon dort stattgefunden hat, dass dort schon genauso seltsame Botschaften zu Körperbildern gesendet worden sind.
Das macht es nicht besser, aber es ist doch beruhigend, zu wissen, dass es das schon immer gab. Wichtig ist es eben, diese Inhalte zu reflektieren. Kinder haben ab einem gewissen Alter durchaus die Reife, solche Dinge zu hinterfragen. Das beobachte ich auch bei meinen eigenen Kindern. Abgesehen davon ist YouTube eben sehr viel mehr als Videos, die problematische Körperbilder vermitteln.
Wie sieht das zum Beispiel aus?
Natürlich finde auch ich es nicht toll, dass meine Tochter Germany‘s Next Topmodel guckt. Aber ich spreche mit ihr darüber und bin dann oft beruhigt – etwa, wenn sie mir erzählt, dass es ja im Grunde gar nicht so sehr um das Aussehen gehe, sondern um Intrigen. Sie erkennt, dass man möglichst schwierige Charaktere weiterkommen lässt, um das Publikum zu unterhalten. Da sehe ich schon viel Reflexionsvermögen.
Bei Youtube kann man nicht nur konsumieren, sondern auch selbst zum Produzenten werden. Sie berichten, dass Ihnen einmal der Kragen geplatzt ist, weil ihr achtjähriger Sohn im Video eines Freundes aufgetaucht ist. Warum?
Vorab muss man sagen, dass man eigentlich 16 Jahre alt sein muss, um einen Youtube-Kanal anlegen zu dürfen. Mit dem Einverständnis der Eltern geht das auch schon mit 13 Jahren. In diesem Alter, oder schlimmer in noch jüngeren Jahren, gibt es viele Dinge, die Kinder noch nicht wissen. Das fängt bei der Beachtung von Urheberrechten an. Es geht aber auch um die Frage, wie viel Informationen man preisgibt, wenn man sich selber filmt. Selbst wenn man da ganz vorsichtig ist, kann es passieren, dass man scharf kritisiert oder das Äußere abgewertet wird. Das sind große Herausforderungen, mit denen Kinder dann umgehen müssen.
Bis zu einem gewissen Alter empfehle ich, Kinder auf jeden Fall zu begleiten, wenn sie Dinge ins Internet stellen wollen. Bei uns hat es sich bewährt, dass wir mit den Kindern vorher genau anschauen, was sie live stellen wollen. Wir sprechen darüber, wo es Probleme geben kann. Manchmal sind es ja schon Banalitäten, wie eine Urkunde von den Bundesjugendspielen, die an der Wand hängt. Dort stehen dann der Klarname und die Schule drauf... Wenn Kinder für solche Dinge sensibel sind, kann man schrittweise dazu übergehen, ohne Freigabe auszukommen. Man sollte Kinder dann aber unbedingt wissen lassen, dass man immer da ist und sie zu einem kommen können, wenn doch mal etwas ist.
Als Kulturoptimistin sehen Sie aber sicher auch Positives darin, dass Kinder bei Youtube oder generell im Internet nicht nur passiv konsumieren, sondern auch selbst etwas gestalten können.
Absolut. Und da gibt es für alle Altersstufen spannende Projekte, bei denen man ziemlich unbesorgt sein kann. Zum Beispiel lassen sich mit simplen Apps Stop-Motion-Videos produzieren, so können schon kleine Kinder mit Knete oder Lego ganze Geschichten erzählen. Für ältere Kinder, die schon gut schreiben und lesen können, gibt es ganz tolle Scratch-Projekte (eine visuelle Programmiersprache für Kinder), bei denen man richtig viel lernt – und das mit Begeisterung. Da müssen sich Eltern dann wirklich keine Sorgen machen, dass eine digitale Demenz eintritt.
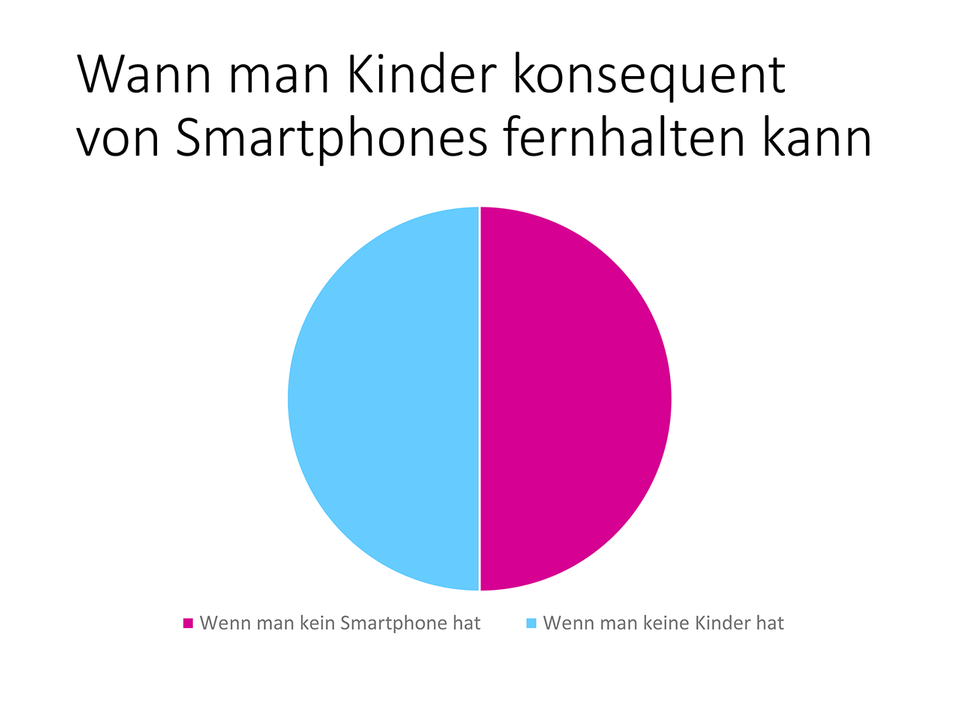
Ihr Buch trägt den Untertitel „Mit Kindern tiefenentspannt durch den Mediendschungel“. Aber bis zur Entspannung steht doch erstmal eine ganze Menge Arbeit an.
Deshalb rate ich dazu, früh anzufangen. Es gibt diesen Kalenderspruch: „Kleine Kinder, kleine Probleme. Große Kinder, große Probleme“. So ähnlich ist es in der Medienerziehung auch. Zu Beginn steht man noch vor der Fragestellung, wie altersgerechte Inhalte aussehen. Und am Ende muss man sich über Uploadfilter und Bildrechte informieren. Doch wenn man diese Wissensaneignung über die Jahre streckt, ist das schon zu bewältigen. Aber klar: Es ist eine kontinuierliche Aufgabe und man muss dranbleiben. Das versuche ich mit meinem Buch auch zu vermitteln.
Andererseits muss vieles überhaupt nicht neu erlernt werden. In der Generation 40 plus trennen etliche Menschen noch stark zwischen analoger und digitaler Welt – und übersehen dabei, dass wir ganz viel Wissen haben, das für beide Welten gilt: Wie man auf der Straße nicht irgendwelchen Menschen sagt, wo man wohnt und in welche Schule man geht, so darf man das auch im Internet nicht machen. Wenn jemand in der normalen Welt etwas kostenlos anbieten sind wir skeptisch, dass sollten wir auch im Internet sein. Und wir alle haben gelernt, respektvoll miteinander umzugehen und nicht einfach andere Leute zu beleidigen.
Wenn Erwachsene verstehen, dass solches Weltwissen auch im Internet gilt, dann können sie das ihren Kindern auch ohne technisches Know-how vermitteln. In der Medienerziehung wäre damit viel gewonnen.