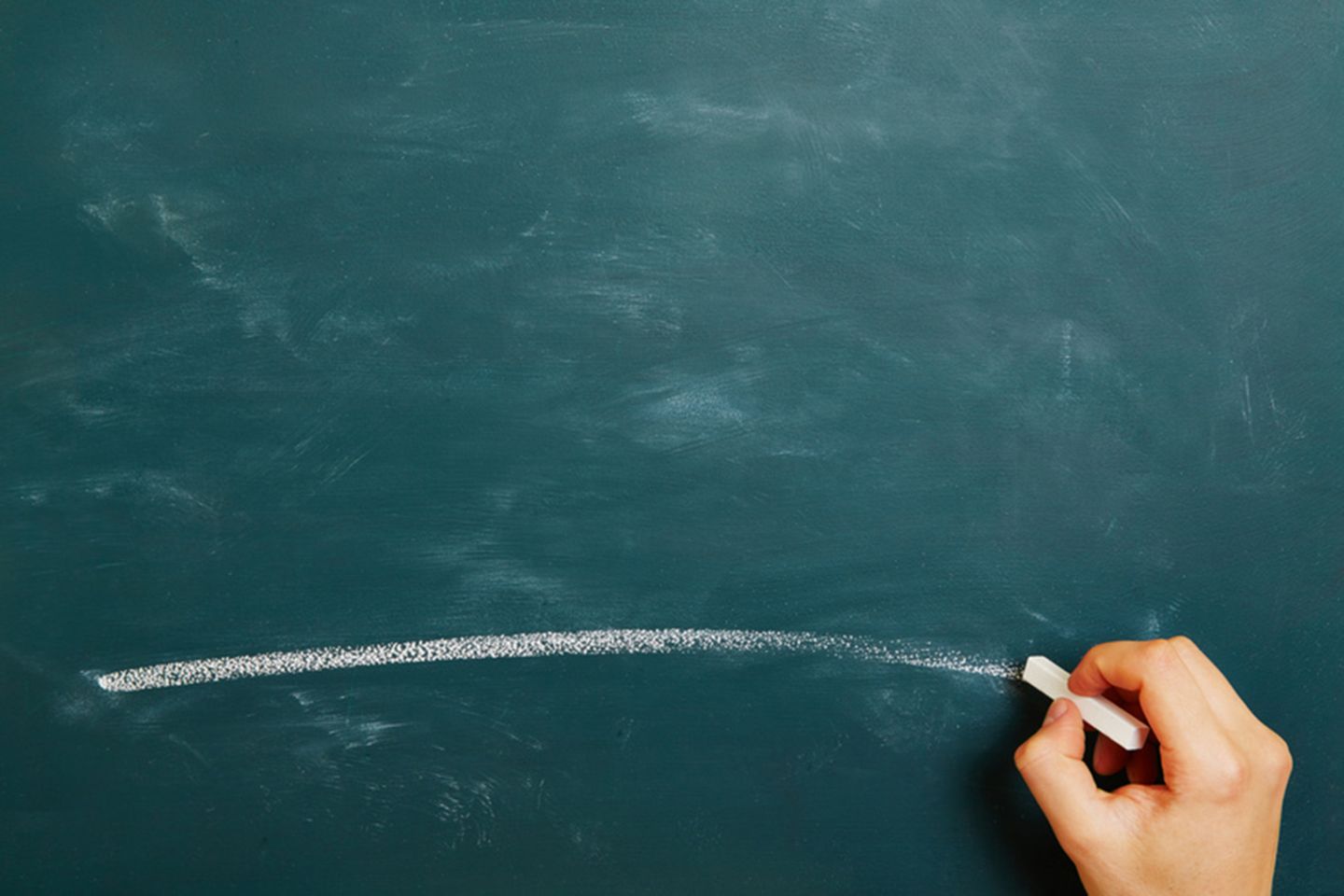Das Lachen eines Babys oder das Gurgeln eines Baches sind Geräusche, die der Mensch als ausgesprochen wohltuend empfindet. Quietschende Kreide dagegen steht ganz oben auf der Liste der unangenehmen Geräusche – gleich nach dem hohen Kreischen, das ein scharfes Messer auf einer Metallflasche erzeugt, und dem schrillen Kratzen einer Gabel auf einem Glas.
Was diese und andere Geräusche im Gehirn bewirken, ermittelte ein britisch-deutsches Forscherteam 2012 mit Hörexperimenten im Kernspintomographen. Das Team untersuchte die Gehirnaktivität von Versuchspersonen, die 74 unterschiedlichen Geräuschen ausgesetzt waren. Das Ergebnis: Wenn jene Schwingungen ertönten, die Kreide, Messer und Gabel erzeugen, löste dies sehr starke Reaktionen im Gefühlszentrum des Denkapparates aus.
Die Misstöne haben eines gemeinsam: Sie entstehen, wenn zwei Gegenstände aneinander vorbeigleiten, dabei jedoch immer wieder ins Stocken geraten. Dieses Ruckgleiten, der sogenannte „Haft-Gleit-Effekt“, beruht darauf, dass es einer größeren Kraft bedarf, um einen ruhenden Körper anzuschieben, als einen gleitenden in Bewegung zu halten.
Folgen Sie uns
Der "Haft-Gleit-Effekt" ist für das Quietschen verantwortlich
Das weiß jeder, der schon einmal versucht hat, einen schweren Schrank zu verrücken: Hat man den Anfangswiderstand, die Haftreibung, überwunden, springt der Schrank ruckartig vorwärts. Ihn dann in Bewegung zu halten, ist weitaus weniger anstrengend, da die Gleitreibung meist bedeutend kleiner ist.
Ähnlich ist es bei der Kreide. Sowohl die Oberfläche der Tafel als auch die Spitze der Kreide sind nicht glatt, sondern ähneln in ihrer Mikrostruktur einer Hügellandschaft. Das Kreidestück kann man sich dabei als elastischen Stab vorstellen, der immer wieder an den winzigen Zacken und Spitzen auf der Tafel hängen bleibt. Die Spitze des Kreidestücks stoppt also, während es an seinem anderen Ende weiterbewegt wird. Dabei biegt es sich ein klein wenig durch.
Wenn aber die Spannung zu groß wird, zerbröselt die Spitze der Kreide, der dabei entstehende Staub verringert die Reibung, die Spitze schnellt nach vorn, und das Stück kehrt in den ursprünglichen, nicht verbogenen Zustand zurück. Anschließend beginnt der Zyklus von Neuem, und zwar im Takt von Millisekunden. Das Ruckgleiten bringt die Kreide ähnlich zum Schwingen wie ein Musiker die Saite seines Instruments.
Wie Wissenschaft uns den Alltag erklärt
Jedem Kind, aber auch vielen Erwachsenen, stellen sich beim Betrachten der Welt um sich herum ähnliche Fragen: Warum etwa steigt heiße Luft auf, wieso plätschert der Bach, weshalb kann man an kalten Tagen seinen Atem sehen, und weswegen blitzt es bei Gewitter? Die GEOkompakt-Ausgabe "Warum ist der Himmel blau? Wie Wissenschaft uns den Alltag erklärt" gibt Antworten auf 50 solche Fragen.
Das Quietschen kann Disco-Lautstärke erreichen
Und jedes Kreidestück hat – je nach seiner Länge – eine „Eigenfrequenz“, bei der es besonders stark mitschwingt, den Ton also verstärkt und für uns hörbar quietscht. Wie Versuche zeigen, hängt die Tonhöhe zusätzlich davon ab, wie man die Kreide über die Tafel führt. Die Lautstärke des Quietschens ist erstaunlich: Es kann, für Bruchteile von Sekunden, einen Lärmpegel erreichen, wie er einen Meter vor dem Lautsprecher einer Diskothek oder vor einem Presslufthammer besteht.
Schrille Geräusche durch den Haft-Gleit-Effekt sind im Alltag weit verbreitet. Die Verursacher sind zum Beispiel Bremsen, Schleifmaschinen, Türscharniere und sogar Turnschuhe auf Parkettfußboden.
Selbst wenn ein Musiker mit seinen Fingerkuppen über den Rand verschieden großer Weingläser streicht und ihnen dabei Töne entlockt, beruht dies auf dem Haft-Gleit-Effekt. Anders gesagt: auf der Physik des Quietschens.