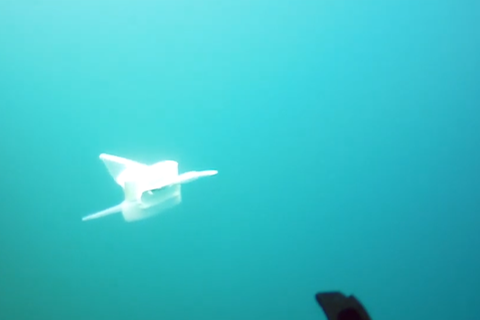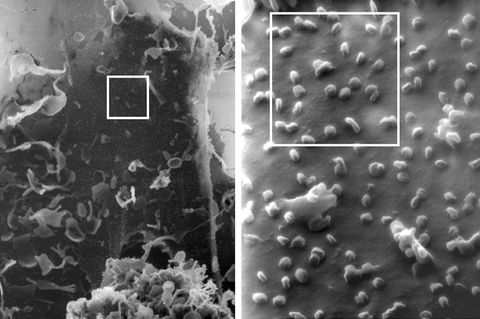1. Station: Leidenschaft entfachen
Die Fahrt mit der Kutsche, er weiß es, wird nicht lange dauern. Vielleicht eine Stunde. Außerdem ist die schöne Frau neben ihm verheiratet. Es wird nicht einfach sein, ihr innerhalb so kurzer Zeit den Kopf zu verdrehen, sogar für ihn nicht. Doch dann wittert der Schürzenjäger seine Chance: Am Himmel ziehen dunkle Wolken auf, bald schon folgt Blitz auf Blitz. "Hundert Schritte vor uns schlägt es ein. Die Pferde bäumen sich, und meine arme Begleiterin zuckt krampfhaft zusammen. Sie wirft sich an meine Brust und umklammert mich ganz fest mit ihren Armen."
Auf das richtige Timing kommt es anOhne Zögern nutzt er die Gelegenheit: "Sie fügte sich und fragte nur, wie ich dem Blitz mit solcher Verruchtheit trotzen könne. Ich erwiderte, der Blitz sei mit mir im Bunde."
Giacomo Casanova (1725-1798) hatte seine Begleiterin im Nu erobert. Was war es bloß, das den italienischen Lebemann und Abenteurer so unwiderstehlich machte? Zugegeben, er sah interessant aus. Er war intelligent, konnte charmant plaudern, und er platzte vor erotischer Leidenschaft. Doch Casanovas entscheidender Vorteil war sein Gefühl für das richtige Timing.
Im Bündnis mit dem Adrenalin
Heute weiß die Wissenschaft, wen Casanova zum Bündnispartner hatte: das Molekül Adrenalin (aus dem Lateinischen ad = zu, renes = Nieren). Dieses Stresshormon wühlt die Gefühle auf. Es bereitet uns nicht nur auf einen bevorstehenden Kampf oder eine Flucht vor. Auch "die Liebe wächst mit dem Adrenalin", wie es die amerikanische Beziehungsforscherin Elaine Hatfield formuliert hat. Den ersten Hinweis darauf lieferte der Psychologe Arthur Aron von der Universität New York in Stony Brook mit dem inzwischen legendären "Brückenversuch": Eine attraktive Mitarbeiterin begab sich in den Capilano Canyon, einen großen Naturpark in der Nähe von Vancouver, Kanada. Dort führte sie eine belanglose Umfrage unter den männlichen Parkbesuchern durch.
Zwei Brücken - zwei ReaktionenFür einige Befragungen stellte sie sich auf eine drei Meter hohe Holzbrücke, für andere auf die "Capilano Canyon Suspension Bridge", die mit 137 Metern längste Fußgängerhängebrücke der Welt, die in 70 Metern Höhe über einen rauschenden Fluss führt. Nach der Umfrage gab die Frau den Männern noch auf der Brücke ihre Telefonnummer - für den Fall, dass sie mehr über das Projekt erfahren wollten.Wie nicht anders zu erwarten, nutzten manche der Männer das Angebot. Dabei stellten die Forscher verblüfft fest, dass die Männer von der Hängebrücke viermal häufiger zum Telefon griffen als jene von der Holzbrücke.
Woher kommt das flaue Gefühl im Magen?
Das Warum erklären die Wissenschaftler so: Eine hohe, wacklige Brücke bedeutet für unser Gehirn "Achtung, Gefahr!" Es reagiert und sendet ein Warnsignal an die Nebennieren, die das in kleinen Bläschen gespeicherte Adrenalin in den Kreislauf abgeben. Dadurch steigt der Blutdruck, schlägt das Herz schneller, werden Körperkräfte mobilisiert. Das Hirn registriert den Alarmzustand und versucht, sich einen Reim aus der unbewusst auftretenden Erregung zu machen. Eine von zwei Ursachen kommt in Betracht: die Brücke oder die Frau. Derart verwirrt, kann es leicht zu Fehlinterpretationen kommen, und das Gehirn entscheidet sich für die falsche Ursache - die Frau. Zitternde Knie und ein flaues Gefühl im Magen, und das wegen einer Frau? Dann, sagt sich das Hirn, muss sie mich schon sehr faszinieren.
2. Station: Attraktivität erkennen
"Schönheit", wusste schon Aristoteles, "ist besser als jeder Empfehlungsbrief." Die Wissenschaft kann dem griechischen Philosophen mittlerweile uneingeschränkt Recht geben. Schönheit wirkt anziehend. Eine Studie des Psychologen Alan Feingold von der Yale University in New Haven ergab: Wir empfinden schöne Menschen nicht nur als sozial kompetenter, sondern auch als klüger, selbstsicherer, geselliger, ausgeglichener und leidenschaftlicher. Aber warum eigentlich? Sollte es nicht vor allem auf die inneren Werte ankommen?
Die Macht der Schönheit haben Forscher erst in den letzten Jahren entschlüsselt - allen voran zwei britische Psychologen namens David Perrett und sein Schüler Ian Penton-Voak von der Universität St. Andrews in Schottland. (Unter www.perceptionlab.com können sich Interessenten an verschiedenen Tests zur Bewertung der Attraktivität von Frauen und Männern beteiligen.)
Wie der ideale Partner aussieht
Die Wissenschaftler setzten Probanden vor einen Computerbildschirm, auf dem Gesichter des jeweils anderen Geschlechts erschienen. Die Testpersonen sollten die Gesichter dann digital so verändern, dass sie ihnen besser gefielen. Wie so oft, verhielten sich die Männer eher einfach gestrickt. Sie korrigierten das Frauenporträt stets auf die gleiche Weise: der Kiefer möglichst schmal, die Augen groß, die Lippen voll. "Das mag wenig überraschend erscheinen", sagt Perrett. "Das Spannende aber ist, dass genau diese Gesichtszüge von den weiblichen Sexualhormonen beeinflusst werden, den Östrogenen."
Was Östrogene bewirkenGebildet werden diese Hormone in gesunden Eierstöcken. Östrogene sind somit ein Zeichen von Fruchtbarkeit, und diese steht der Frau offenbar ins Gesicht geschrieben: Östrogene hemmen das Knochenwachstum, so bleibt der Kiefer klein. Auch der Wulst über den Augenbrauen wächst weniger stark als bei Männern, dadurch wirken die Augen größer. Außerdem führen die Hormone zu Fettablagerungen in den Lippen, sie werden voller. "Schönheit ist nicht nur ein oberflächlicher Luxus", sagt Perrett. "Sie ist ein biologisches Signal." Es bedeutet: Ich bin fruchtbar.
Und die Frauen? Bei ihrer Partnerwahl hilft auch ihnen ein Hormon: das Testosteron. Das männliche Sexualhormon wird vor allem in den Hoden gebildet. Testosteron ist für die Bildung von Eiweißgewebe zuständig. Je mehr Testosteron, desto mehr Muskeln. Außerdem fördert das Hormon die körperliche Leistungskraft und das Streben nach Dominanz. Wie das Östrogen der Frau, so steht dem Mann das Testosteron ins Gesicht geschrieben: Das Alphatier-Hormon kurbelt das Knochenwachstum an, verhilft zu einem kantigen Kiefer und einem ausgeprägten Kinn.
3. Station: Verstand verlieren
Beiderseitige Attraktivität reicht jedoch nicht aus, damit zwei Menschen auch zusammenbleiben. "Wer verliebt ist, der ist auch ein bisschen verrückt", sagt die Psychiaterin Donatella Marazziti von der Universität Pisa. Nur so könnten es zwei Menschen, die sich kaum kennen, miteinander aushalten. Ein Verliebter befinde sich in einem Zustand, der sich mit zwanghaftem Verhalten vergleichen lasse - wie bei einem Menschen, der sich 43-mal am Tag die Hände wasche. Bei der Verliebtheit, so Marazziti, seien es jedoch nicht bestimmte Handlungen, die einen zwanghaften Charakter annähmen, sondern die Gedanken. Alle kreisten nur noch um die angehimmelte Person. Um ihre Annahme zu überprüfen, untersuchte die Forscherin 20 Studentinnen und Studenten, die sich im zurückliegenden halben Jahr bis über beide Ohren verliebt hatten, aber noch keine Beziehung eingegangen waren. Mindestens vier Stunden täglich, gaben die Probanden an, dachten sie einzig und allein an das Objekt ihrer Begierde.
Verliebte verhalten sich wie Neurotiker
Nicht nur ihr Geisteszustand hatte zwangsneurotische Züge angenommen. Ein Bluttest offenbarte: Auch ein bestimmter Stoff in ihrem Körper, das Serotonin, war auf ein extrem niedriges Niveau gesunken. Der gleiche Befund zeigt sich bei Zwangspatienten. Es lassen sich mithin biochemische Parallelen nachweisen zwischen einer Neurose und dem Zustand der Verliebtheit. Marazziti fand überdies heraus, dass sich frisch Verliebte ähnlicher werden - zumindest biochemisch. Normalerweise zirkuliert im Blut von Männern deutlich mehr Testosteron als bei Frauen. Doch wenn Menschen von der Liebe entflammt sind, sinkt sein Testosteron-Spiegel, ihrer hingegen steigt. "Männer werden in gewisser Weise weiblicher, Frauen eher männlicher", sagt Marazziti. "Es scheint, als wolle die Natur die Unterschiede zwischen den Geschlechtern einebnen."
Dopamin macht Verliebte high
Dass Verliebte darüber hinaus sogar manisch sind, entdeckte die New Yorker Anthropologin Helen Fisher. Sie untersuchte die Hirnaktivität von Männern und Frauen mithilfe eines Kernspintomographen, während diese ein Bild ihres oder ihrer Liebsten ansahen. Der Befund: Die Verliebten wirkten, als hätten sie gerade Kokain geschnupft. Ihre Gehirne waren von dem Molekül Dopamin überflutet. Je größer ihre mittels Fragebogen festgestellte Leidenschaft war, desto mehr Aktivität zeigte sich im so genannten Nucleus caudatus, einem Kern der Basalganglien, in dem Dopamin verarbeitet wird. Die Basalganglien liegen im Zentrum des Gehirns und gehören zu dessen so genanntem Belohnungssystem. Immer wenn wir etwas tun, das im Dienste der Evolution steht, wenn wir essen, trinken oder Sex haben, schüttet das Gehirn Dopamin aus. Der Botenstoff aktiviert die Belohnungsareale, und wir fühlen uns gut.
"Dopamin ist ein wahres Lustmolekül", sagt Isabella Heuser, Direktorin der Klinik für Psychiatrie an der Berliner Charité. Es steigere vor allem das Begehren. "Kein Wunder", sagt Helen Fisher, "dass Verliebte die ganze Nacht durchreden können, extravagante Gedichte oder offenherzige E-Mails schreiben, Kontinente überqueren und Ozeane, nur, um sich ein Wochenende lang zu umarmen."
4. Station: Sex haben
Nichts jedoch treibt den Dopamin-Pegel so in die Höhe wie Sex. Was Hirnforscher seit jeher vermutet hatten, konnte der Niederländer Gert Holstege von der Universität Groningen kürzlich experimentell nachweisen.
Er legte elf Männer in einen Positronen-Emissions-Tomographen (PET) und verfolgte die Erregung in ihrem Kopf, während sich die Probanden von ihren Partnerinnen per Hand befriedigen ließen. Holstege hatte die Pärchen dazu aufgefordert, den Vorgang vorher zu Hause ausführlich zu trainieren. Denn bei der Messung mussten die Männer zwei Schwierigkeiten überwinden: Sie durften sich nicht bewegen und sollten innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens von 50 Sekunden zum Höhepunkt kommen.
"Liebe funktioniert wie eine Droge"
Das Ergebnis war aufschlussreich: Während des Orgasmus leuchtete vor allem das so genannte ventrale Tegmentum auf - der wichtigste Bestandteil des Belohnungssystems, "die Hauptader des Dopamins", wie Fisher es formuliert. Auch Drogen wie Alkohol und Kokain setzen massenhaft Dopamin im Belohnungssystem frei. Das High, das wir diesen Hirnarealen verdanken, wollen wir wieder und wieder erleben. "Liebe funktioniert wie eine Droge", sagt Fisher.
Mithilfe des Dopamins stellt die Natur sicher, dass sich zwei Menschen aneinander binden und Nachwuchs zeugen. Dass wir dabei vorübergehend den Verstand verlieren, ist der Preis dafür, wenn auch kein unangenehmer. "Liebe", bemerkte der französische Schriftsteller Marcel Aymé (1902 bis 1967), "ist der angenehmste Zustand teilweiser Unzurechnungsfähigkeit."
5. Station: Sich fest binden
Doch jede stürmische Leidenschaft legt sich irgendwann, die Zurechnungsfähigkeit kehrt zurück. Das zeigte sich, als die italienische Psychiaterin Donatella Marazziti ein bis anderthalb Jahre nach der ersten Untersuchung einige der vormals Liebeskranken noch einmal zur Visite bat. Alle waren inzwischen eine Bindung mit ihrem Schwarm eingegangen. Doch damit war auch ihr Serotoninspiegel wieder auf normales Niveau gestiegen.
Der Tunnelblick verschwindet, die Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf die Erfordernisse des Alltags. An dem Punkt ist manche Liebe in Ge-fahr. Bei einigen Paaren stirbt sie sogar ganz. Denn plötzlich fallen einem "Fehler" des Partners auf, die im Licht der Leidenschaft noch charmant erschienen. Wem es nicht gelingt, diese zu akzeptieren, dem droht bald der Bankrott der Beziehung - und das früher, als Menschen gemeinhin glauben, hat Helen Fisher festgestellt.
Der verflixte dritte Jahr
Die Anthropologin vertiefte sich in die demographischen Jahrbücher der Vereinten Nationen und studierte die Scheidungsstatistiken von 62 Ländern: Der Großteil der geschiedenen Ehen löste sich zwischen dem zweiten und vierten Jahr auf. "Das ,verflixte siebte Jahr'", so das Fazit der Forscherin, "war in Wirklichkeit das vierte." Helen Fisher deutet das Phänomen als eine Folge unserer Entwicklungsgeschichte: Nach vier Jahren sind die Kinder aus dem Gröbsten heraus. Der Auftrag der Natur hat sich erfüllt, die Paare überdenken die Partnerschaft und lösen sich voneinander. Aber es gibt auch Stoffe, die langfristig aneinander binden. Zwei dieser biochemischen Bindemittel haben Biologen besonders erforscht: Oxytocin und Vasopressin. Sie werden ebenfalls vor allem beim Sex freigesetzt.
Die Präriewühlmaus macht's vor
Genauer untersucht als "Moleküle der Monogamie" wurden sie zunächst nicht beim Menschen, sondern bei der Präriewühlmaus. Die flauschigen Geschöpfe aus den Graslandschaften Nordamerikas sind Beleg dafür, wie wenig es mitunter zur lebenslangen Bindung bedarf. Wenn sich eine Wühlmaus für einen Partner entschieden hat, weicht sie diesem nie mehr von der Seite. Stirbt einer von beiden, bleibt der andere bis zum Tod allein.
Auslöser dieser Treue ist ein Rauschzustand, der etwa 24 Stunden anhält: Weibchen und Männchen geben sich dabei der Leidenschaft hin, paaren sich zwei Dutzend Mal. Dabei produziert das Hirn des Weibchens eine hohe Dosis Oxytocin, während das des Männchens mit Vasopressin überschüttet wird. Nach dieser "Gehirn-wäsche" sind die Tiere auf absolute Monogamie eingestellt.
6. Station: Dauerhaft glücklich werden
Ein weiteres Rezept für eine lange Liebe glaubt der US-Psychologe Arthur Aron entdeckt zu haben. Die Aufregung und das Adrenalin, die die anfängliche Leidenschaft entfacht haben, seien auch die besten Mittel, die Liebe langfristig lebendig zu erhalten. Um seine Vermutung zu testen, band Aron Paare an Händen und Füßen zusammen und schickte sie in einer Turnhalle gemeinsam auf einen Hindernisparcours. Die Pärchen sollten dabei ein Kissen mitnehmen, das sie nur zwischen ihre Köpfe oder Körper klemmen konnten. Vor und nach dieser Übung ermittelte der Forscher, wie zufrieden die Paare mit ihrer Beziehung waren. Das Resultat: Nachdem die Fesseln gelöst waren, fühlten sich die Partner einander näher als noch kurze Zeit vor dem Experiment. "Gemeinsame Herausforderungen", lautet Arons Fazit, mögen sie uns auch noch so einfach erscheinen, "schweißen ein Paar zusammen."
Auf der Suche nach dem Adrenalin
Dass so etwas auch langfristige Auswirkungen haben kann, zeigte sich in einem weiteren Versuch. Aron teilte Ehepaare, die im Durchschnitt länger als 14 Jahre verheiratet waren, in zwei Gruppen ein. Der einen verschrieb er jede Woche anderthalb Stunden eine aufregende Tätigkeit: einen Berg besteigen, Skifahren, ins Konzert oder zum Tanzen gehen. Die andere Gruppe musste sich mit Aktivitäten begnügen, die sie zwar als angenehm, jedoch nicht als sonderlich aufregend empfand, wie Freunde besuchen oder gemeinsam kochen. Zehn Wochen später befragte der Forscher die Paare nach ihrem Eheglück. Die erste Gruppe war mit ihrer Partnerschaft eindeutig zufriedener als zuvor. Bei der anderen hatte sich so gut wie nichts verändert. Die Liebe, sagt Arthur Aron, muss also nicht zwangsläufig der Gewohnheit weichen. Zwar überfällt sie den Menschen wie ein Fieber, aber ihr ebenso rasches Schwinden lässt sich verhindern. Liebe ist, glaubt der Forscher, wenn man sich immer wieder auf die Suche nach dem Adrenalin macht - gemeinsam.