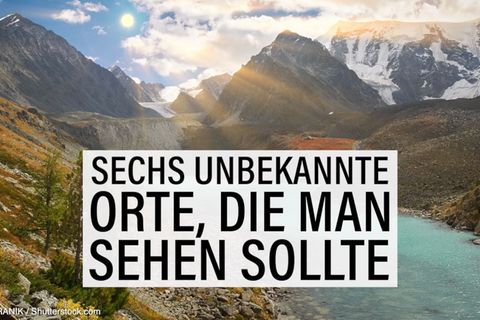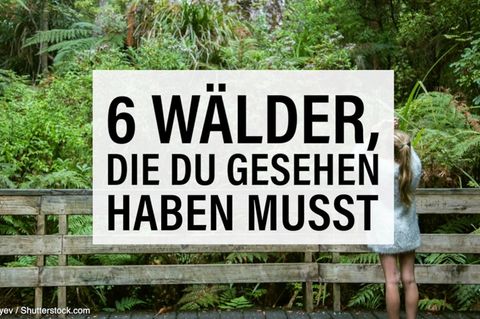Das Ende von Russland?
"Eine Reise nach Wladiwostock", sagt Pawel Wyschniak, "sollte über das Meer führen." Es sei eine Frage der Perspektive: Erreiche man Russlands Fernost-Hafen per Schiff, begreife man ihn sofort als ein Tor zu Asien. Auf dem Landweg hingegen, zum Beispiel als Reisender auf dem Transsibirien-Express, könne man sich bei der Ankunft in Wladiwostok kaum noch von der Vorstellung lösen, dass diese Stadt sechs Zugnächte östlich von Moskau liegt und ihre 600.000 Einwohner am äußeren Rand des Reichs leben müssen, sieben Zeitzonen vom Zentrum entfernt. In der Verbannung.
Die Themen: Aktuelle Reisetipps; Gespräch: Maike Dugaro befragte GEO-Reporter Michael Stührenberg, der das neue GEO-Special-Heft "Russland" betreut hat; Lehmanns Liste II; Rätsel. Moderation: Matthias Unger (Länge: 14:42 Min.; 16,8 MB).
Das Ende von Russland?
"Das ist die große Frage", sagt Wyschniak: "Sind wir das Ende von Russland oder der Anfang von Asien?" Pawel Wyschniak ist Millionär. Und vor der Arroganz des Reichen geschützt, weil er auch Fußballnarr, Rockfan und ehemaliger russischer Landesmeister im Kegeln ist. Als überzeugter Vertreter der Devise "Wladiwostok liegt am Meer!" braust er an fast jedem Sommerwochenende im Boot aus dem Hafen, vorbei am kurzen Leuchtturm, der die Öffnung der Bucht markiert, und hinaus zu Inseln, die ihm wie Wladiwostoks maritime Vororte erscheinen. An diesem Morgen hält Wyschniak auf Rikorda zu. Bewaldete Ufer, ein Hügel im Inselzentrum, das Eiland wirkt völlig verlassen.
Der Bootsmann wirft den Anker. Wyschniak hechtet ins warme Wasser - Rikorda liegt auf einer Höhe mit Monaco - und krault die letzten 100 Meter bis zum Ufer. Dort folgt er einem Trampelpfad, der zu einer Müllgrube und einem Plumpsklo führt, kurz davor jedoch auch zu einem Holztisch abzweigt, gedeckt mit Jakobsmuscheln, Seegurken, Schrimps - so unvermutet wie das "Tischlein deck dich".
Die kosmische Röhre von Rikorda
Rikorda ist die kulinarisch-philosophische Ausdruckswelt des Gennadi Fetejewitsch. Unter hohen Bäumen seines Inselwaldes stehend, hebt der Züchter von Meeresfrüchten und Bewirter von Millionären zum Gruß sein Wodkaglas und erzählt seine liebste Anekdote: "CIA und KGB haben intensiv geforscht: Warum zieht eine so kleine Insel so wichtige Männer an? Nun wissen wir die Antwort: Weil über Rikorda eine kosmische Röhre hängt!" Fetejewitsch lacht und bringt einen Toast aus: "Auf alle wichtigen Leute, die nach Rikorda kommen!" Auf Männer wie Roman Abramowitsch also, der mit sibirischem Öl den FC Chelsea gekauft hat.
Die Zukunft heißt Ostasien
So groß war seine Yacht, dass sie weit vor Rikordas Ufern ankern musste. Bodyguards stürmten die Insel, bevor sich der Oligarch zu den Mücken in den Wald setzte und eine Portion Jakobsmuscheln bestellte. Auch Michail Chodorkowski hat an diesem Tisch gespeist. Damals, als er noch die Gnade von Putin und das Vermögen von Yukos besaß. Und nun sitzt Pawel Wyschniak an der Tafel der neuen Fürsten. Ein Selfmademan in Badehose. Begonnen hat er seine Karriere als Sportredakteur einer Wladiwostoker Lokalgazette. Nun, mit 40 Jahren, ist er Herausgeber von sieben Zeitungen, Besitzer von 250 Kiosken und Herrscher über die rund 1000 Angestellten von "Vladpressa Inc.".
Die Zukunft heißt Ostasien
Ein Mann, der an Wladiwostok glaubt und keine Gelegenheit auslässt, sein Credo zu proklamieren: "Unsere Zukunft heißt Ostasien. Unsere nächsten Nachbarn sind China, Korea und Japan. Gemeinsam werden wir uns in einen pazifischen Wirtschaftsraum integrieren." Er lächelt, vielleicht fällt ihm die ungewollte Ironie in seinen Worten auf. Denn Pawel Wyschniak ist nicht über Geschäfte mit ostasiatischen Nachbarn reich geworden, sondern, im Gegenteil, dadurch, dass er Wladiwostok noch fester an das europäische Russland gekettet hat. Als die Perestroika Anfang der 1990er Jahre den Pazifik erreichte, entdeckte Wyschniak seine Chance in dem Info-Jetlag der sterbenden Sowjetära: Gedruckte Nachrichten brauchten oft zwei Tage, um von Moskau nach Wladiwostok zu gelangen, und schmeckten bei ihrer Ankunft recht abgestanden. Vor allem im Sport: Wen interessiert schon ein Ligaspiel, das vor 48 Stunden abgepfiffen wurde?
Alle Fenster sind zerschossen
Dank moderner Technologien, eines besseren Transportwesens und einer effizienteren Organisation als der des sowjetischen Pressevertriebs sorgt Wyschniak nun dafür, dass Wladiwostok, was gedruckte russische News anbelangt, fast in derselben Zeitzone zu liegen kommt wie Moskau. Nach dem Mittagessen führt Fetejewitsch zu der aufgedockten Dschunke am Ufer: seiner Wohnung. Alle Fenster sind zerschossen: "Neulich kamen Gangster in einem Schnellboot und haben drei Tonnen Meeresfrüchte geklaut!" Während die Kugeln pfiffen, hockte Fetejewitsch in der Dschunke und betete. War es die "kosmische Röhre", die ihn an jenem Tag gerettet hat? Auf jeden Fall, meint der Inselgastwirt, habe Wladiwostok "dasselbe Geschäftsklima wie Moskau" - und nicht etwa jenes wie Tokio, Seoul oder Beijing. Also liegt die Stadt womöglich doch nicht am Anfang von Asien, sondern am Ende von Europa.
"Wladiwostocker sehen sich als Seeleute", sagt Nikolaj Sortschenko. Oder besser, als Leute der See, Bewohner einer Stadt, die keinem Kontinent angehört, sondern eine Verlängerung des Meeres darstellt. Auf jeden Fall ein pazifischer Ort, weshalb Sortschenko auch als Inhaber des Traumjobs von Wladiwostok gelten kann: Er ist Kapitän der "Pallada", eines Dreimasters mit 26 Segeln und 143 Kadetten an Bord. Ein Schulschiff, das es noch immer mit allen sieben Meeren aufnimmt. "Die ‚Pallada‘ ist das Wahrzeichen von Wladiwostok", sagt Sortschenko, auch er ein Mann von Trinksprüchen.
Gerade hat er unter einer Sitzbank in der Offiziersmesse einen Schnaps hervorgekramt, hat eilig ein paar kleine Gläser gefüllt und das seine zum ersten Toast erhoben: "Auf ewige Rückkehr!" In der Regel ist sein Schiff die Hälfte des Jahres unterwegs. Und jedesmal, wenn es gen Heimat segelt und in die Bucht des Goldenen Horns einläuft, erkennt Sortschenko schon von weitem im Gesicht seiner Stadt die Züge einer glorreichen Vergangenheit und noch immer lohnenswerten Zukunft.
Größte maritime Festung der Welt
Einlaufenden Seeleuten erscheint Wladiwostok oft wie ein Gemälde, von dem als erstes der Rahmen auffällt: die Kammlinie einer dicht bewaldeten Taiga über der Stadt. Und die Bergrücken an ihren Flanken. Dort sind Anfang des 20. Jahrhunderts eine Reihe von unterirdischen Verteidigungsstellungen angelegt worden, teilweise miteinander verbunden durch ein Labyrinth kalter, feuchter Gänge, in denen die gesamte Stadtbevölkerung im Falle eines japanischen Angriffs hätte Platz finden sollen.
Größte maritime Festung der Welt
Der Plan ist nie zur Anwendung gekommen. Dennoch rühmt Kapitän Sortschenko seine Stadt als "größte maritime Festung der Welt". Gegründet wurde Wladiwostok 1860, von der Besatzung des Kriegsschiffes "Mantschur" und im Auftrag des Zaren Alexander II., der damit die Eroberung des Kontinents hinter dem Ural abzuschließen gedachte. Daher der Name "wladiwostok" - "Beherrsche den Osten!" Erreicht die heimkehrende "Pallada" die Einfahrt zum Hafenbecken, kann Sortschenko sich auf die Details im Gemälde konzentrieren. Zum Beispiel die Kalamarfischer. Deren Kutter, überspannt von Reigen dicker Glühbirnen, wirken so lustig wie Boote für Hafenrundfahrten. Auf der Uferpromenade leuchtet der grüne Leib von "C-56", einem U-Boot. An Wochenenden posieren dort immer Hochzeitspaare. "Einen Seemann zu heiraten", prahlt der Kapitän, "gilt bei uns als Inbegriff des gesellschaftlichen Aufstiegs, sogar für eine Professorin!"
Auch die grauen Leiber einiger Kriegsschiffe kann Sortschenko bei seinem Einlaufen ausmachen. Die Reste der sowjetischen Pazifikflotte! Die meisten ihrer Schiffe sind seit der Perestroika verschrottet, verscherbelt oder in andere Häfen verlegt worden. Dabei hat doch gerade die Flotte die Geschichte von Wladiwostok ganz entscheidend beeinflusst. Ein zweites Glas, ein zweiter Toast: "Auf unsere Pazifikflotte!" Denn die Pazifikflotte hat "Wladik" zu einer Stadt von Helden erhoben. Tausende Flotten-Angehörige wurden im Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, einige von ihnen sogar mit dem Titel "Held der Sowjetunion"!
Stalin sorgte für ethnische Reinheit
Patriotische Zeiten waren das. Ihr Status als Heimathafen der Kriegsflotte machte die Stadt zum militärischen Sperrgebiet: zur "verbotenen Stadt", umwoben von Mythen und Legenden schrecklichster Art. Etwa darüber, wie Stalin dort für "ethnische Reinheit" sorgte: Zehntausende Koreaner und Chinesen, die bis dahin die Mehrheit in Wladiwostok stellten, hatte der Diktator erschießen oder verschleppen lassen. Deshalb konnte Wladik trotz seiner fernöstlichen Lage nicht zu einem melting pot werden. Nichts durfte sich unter Stalins Aufsicht hier vermischen: keine Völker, keiner Kulturen, keine Ideen. Aber ist es nicht gerade sein europäisches Antlitz, das Wladiwostok für anlandende Seefahrer so attraktiv macht? Zwar hatte Chruschtschow die Stadt zum "San Francisco der Sowjetunion" gestalten wollen, wegen der schönen Bucht und der vielen Hügel. Wie ihr kalifornisches Vorbild ist die Stadt ein ständiges Auf und Ab, durchkreuzt von Trolleybussen und Straßenbahnen.
Eine Gemischtwarenhandlung am Ende der Welt
Erschaffen haben die sowjetischen Stadtplaner dann aber eine Skyline des realen Sozialismus. Über Außenbezirken ragen Proletarierkasernen, die schlimmsten stammen aus der Breschnew-Zeit: schmucklose Betonquader gefüllt mit "Gostinki", Ein-Zimmer-Behausungen. Doch die "Schlachtschiffe", wie die öden Bauten im Ortsjargon heißen, dienen dem gelandeten Seemann nur als Kontrast. In ihrem Schatten findet er das echte Wladiwostok. Die ersten Militärgouverneure der Region waren nämlich Baltendeutsche. Und die schufen sich ein Stadtbild nach Vorstellungen aus der alten Heimat. So reihen sich heute hanseatisch anmutende Häuser auf der Swetlanskaja, der Hauptstraße im Herzen der Altstadt. Das imposanteste von ihnen, Kaufhaus GUM, hieß früher "Kunst & Albers". Es gehörte zwei Hamburgern, die sich in den Kopf gesetzt hatten, 1864 eine Gemischtwarenhandlung am Ende ihrer Welt zu eröffnen.
Die Stadt der Seeleute
An Bord der "Pallada" hebt der Kapitän erneut sein Glas, es wird still in der Offiziersmesse. Der dritte Toast ist heilig, ein Ritual in dieser Stadt: "Auf jene draußen!" Er gilt jenen, auf die Wladiwostok noch immer wartet; und denen, auf die kein Warten mehr lohnt. Auf dem Stadtfriedhof stehen einige Gräber leer, jedes von ihnen einer verschollenen Schiffsmannschaft gewidmet. "Kehren russische Seeleute nicht zurück, haben wir immer das Gefühl, ihr Heimathafen sei Wladiwostok gewesen", erklärt Sortschenko. Auch wenn es, wie im Fall des russischen Atom-U-Boots "Kursk" in Wahrheit Murmansk war. Es wird spät, von Deck her ist das Trampeln und Schlurfen vieler Schritte zu vernehmen. Die Kadetten der "Pallada" stellen sich zum Appell auf. Kapitän Sortschenko erhebt sein Glas zu einem vierten, einem erleichterten Toast: "Auf unser Wladiwostok! Auf die Stadt der Seeleute!"
"Ohne uns wäre Wladiwostock verhungert!" Tatjana Biriosa, 40, durchwandert kräftigen Schrittes eine endlos scheinende Blechlandschaft am Rand der Stadt. Lauter Autos - zu Reihen, Kolonnen, Bataillonen geordnet. Und nur japanische Marken: Honda, Mazda, Nissan, Toyota. Der größte Gebrauchtwagenmarkt in Russland, bewacht von privaten Milizionären in Tarnuniformen und mit Kalaschnikows ausgestattet.
Rubel eignen sich nicht für den Kleinhandel
Frau Biriosa nickt Kollegen zu. Die meisten Händler lehnen an Kotflügeln. Rauchen. Warten. Andere tun, als ließe das Geschäft sie nicht zur Ruhe kommen. Wischen etwa den auf einer Windschutzscheibe markierten Preis von 8200 weg - Dollar natürlich, Rubel eignen sich nur für den Kleinhandel - und malen ihn dann mit schwarzem Filzstift genauso wieder hin. Frau Biriosa sagt: "Jeden Monat holen wir 10.000 Gebrauchtwagen aus Japan. Seit der Lokalbedarf gedeckt ist, schicken wir die meisten Fahrzeuge weiter nach Westen, per Transsib nach Nowosibirsk, Kasachstan oder Europa. Ein Toyota Landcruiser kostet hier 15.000 Dollar weniger als in Moskau." Das Geschäft begann vor rund 15 Jahren. Damals lag Wladiwostok am Boden. "Es war wie nach einem Krieg", berichtet die Autohändlerin. "In der Stadt wüteten Plünderer, herrschte das Elend."
Von den Obrigkeiten konnten die Wladiwostoker keine Hilfe erwarten - die gehörten oft selbst zu den Plünderern. Die Sowjetunion war tot, kriminelle Banden kämpften um ihren Erbteil, morgens lagen oft Leichen auf dem Pflaster. High Noon am Pazifik. Jene, die heute über Wladiwostok und die Primorje-Region herrschen, sind die Gewinner aus dem Chaos jener Tage. Gouverneur und Bürgermeister, beide landesweit die Jüngsten in ihrem Amte, der eine 42, der andere 32 Jahre alt, sind noch immer unter ihren Unterweltsnamen bekannt: der Gouverneur als "Sergej der Lispler" (wegen der feuchten Aussprache), der Bürgermeister als "Winnie Puh" (wegen des runden Kopfes). Das wagen sogar Moskauer Medien zu behaupten, obwohl die beiden geläuterten "Businessmen" nun Putins Macht in Russlands Fernem Osten verkörpern.
Das Volk war in jenen Tagen auf sich selbst gestellt, und Leute wie Tatjana Biriosa schritten zur Tat. Heute hat sie zwar Handy, Computer und einen Partner in Übersee. Anfangs jedoch fuhr sie noch selbst mit der Fähre nach Japan. Kaufte ein billiges Auto oder zwei, verhandelte mit den Reedern russischer Holzfrachter, die ebenfalls kein Auskommen mehr fanden.
Brücke zwischen Asien und Europa
Dank Fantasie und guten Willens ist es ihnen gelungen, die Holzfrachter in Auto-Transporter zu verwandeln. So hat das Kleinunternehmertum Wladiwostok gerettet - und der Stadt ein neues Gesicht verliehen. Früher versorgten Fischerei und Flottenindustrie über die Hälfte der aktiven Bevölkerung. Heute beschäftigt dieser Sektor nur noch 30.000 Arbeitnehmer; fast 100.000 hingegen ernähren sich und ihre Familien vom Autohandel. Nur dass Wladiwostok keines seiner Autos selber herstellt. "Unsere Zukunft", schwärmt Larissa Dmitrijewna Belobrowa, "liegt in der Weltoffenheit. Sie macht uns zur Brücke zwischen Asien und Europa." Larissa, die ganze Stadt nennt sie bei ihrem Künstlernamen, ist Russlands berühmteste Theaterschauspielerin östlich des Urals. Außerdem ist sie die Gemahlin des Gouverneurs und damit Première Dame von Wladiwostok. Jetzt revidiert sie falsche orstellungen: "Wladiwostok war nie so, wie der Westen es sich vorgestellt hat. "Mein Mann und ich waren in Monaco", fährt Larissa fort, "die Geschichte von Grace Kelly und Prince Rainier hat uns sehr bewegt."
Die Schauspielerin und der Fürst
Die Schauspielerin und der Fürst! Vom Traumpaar am Mittelmeer inspiriert, machte sich Larissa daran, das kulturelle Leben in Wladiwostok zu verfeineren: durch Ausstellungen, Talente-Förderung, Festivals für Jazz oder Klassische Musik. Und mit einem Filmfest. Alljährlich im Juni, seit 2001, organisiert Larissa das Internationale Filmfestival für den pazifischen Raum. Mit Teilnehmern aus China, Japan, Taiwan und Südkorea, aber auch aus Ländern wie Peru, die ja auf der anderen Seite des Meers liegen.
Zur Preisverleihung lädt sie dann den verarmten Filius von Yul Brynner, dem berühmtesten Sohn der Stadt, aus New York ein. Um der Veranstaltung mehr internationales Flair zu verleihen. "Wladik wird wie Cannes", glaubt Larissa: "Kultur mit Strand."
Der Weg bis dahin mag manchem noch etwas weit erscheinen. Vom Festivalpalast "Kino Okean" führt eine rissige Betontreppe hinab zum Stadtstrand am Amurski Golf: zu lädierten Bänken, Scherben, Zigarettenstummeln und der Statue einer barbusigen Seejungfrau im seichten Wasser. Aus Zelten am Wasserrand weht ein Hauch von Bier und getrocknetem Tintenfisch. Und vor dem Riesenrad an der Uferpromenade wartet ein gestrandeter Matrose mit einem Affen in Kapitänsuniform. "Captain Vlad" heißt das Tier. Bleibt ein Tourist stehen, hüpft ihm der Affe auf die Schulter; der Matrose knipst ein Souvenir-Foto. Als Erinnerung an das Ende von Europa. Oder den Anfang von Asien. Dafür verlangt der Mann dann 50 Rubel.
Fotograf Pascal Maitre, 51, und Reporter Michael Stührenberg, 53, beide aus Paris, waren für GEO zuletzt auf Madagaskar 02/2006 und am Tschadsee 04/2006.Wladiwostok kam den beiden verwirrend vertraut vor: wie die spiegelverkehrte Ansicht eines Bilds. Maitre fuhr nachts mit einem Kalamar-Schlepper aus, wie es sie zuhauf an der französischen Küste gibt. Stührenberg leistete Amtshilfe in der Pauluskirche und half Manfred Brockmann, ehemals Pastor einer Hamburger Gemeinde, in dessen Talar.