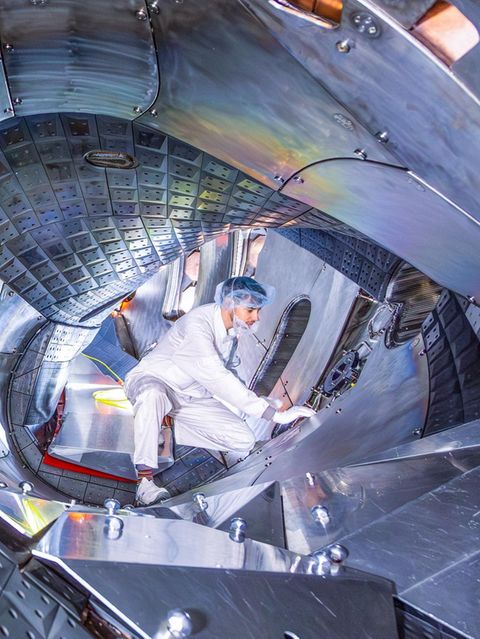Das Göttliche, es hängt am Abgrund. Kerzen erhellen im Inneren das winzige Gemäuer, draußen dreht ein Adler seine Runden. Über Steineichen und Oleander geht sein Flug, über Olivenbäume und Macchia, verdorrt von der Sommersonne. Rund um die Andachtskapelle des Klosters Spiliotissa, errichtet auf einem steil abfallenden Felsplateau, streicht an diesem strahlend durchsichtigen Herbsttag ein würziger Wind. Sanft ist er zu uns Wanderern, und erfrischend zugleich, hoch über der Bucht der Stadt Limeni. Ich nehme einen Schluck samtiges Quellwasser – kurz zuvor gezapft im Bergdorf Keléfa, Heimat für 39 Menschen, diverses Geflügel, sieben Ziegen und einen Bock.
Wir wandern mit Ervin Witowschi, der hier, auf dem Mittelfinger des Peloponnes, mit seiner Frau Tina Tsapatsari geführte Touren anbietet. Auf nur 75 Kilometer Länge und sechs bis acht Kilometer Breite, umflossen vom Messenischen und Lakonischen Golf, kommen wir im Norden auf der Halbinsel durch verwunschene, grüne Laubwälder, rund um das von mächtigen Bergzügen gerahmte Kardamili; im Süden liegen zerklüftete, nackte Hänge. Dazwischen, um die Küstenstadt Limeni, erwandern wir uns eine grandios herbe Landschaft voller Steine und uralter Olivenhaine. Abwechselnd blicken wir auf das Meer und die Berge. In Vor- wie auch Nachsaison lassen sich auf der Mani Bewegungsdrang und Genussmomente wunderbar vereinen.
Ervin, Mitte 40, gebürtiger Rumäne, und die aus dem nahen Areopoli, stammende Tina präsentieren im leuchtenden Herbst bis weit in den November hinein auf versteckten Pfaden ein Griechenland, das so archaisch anmutet, dass man sich zwickt: Ist das wirklich noch Europa? So ursprünglich und offensichtlich kaum bereist?
Was Sie in der Mani erleben können
- Outdoor: Wandern, Klettern, Schwimmen, Rad- oder Scooterfahren ist hier erste Wahl. Geführte Radtouren durch »Messenien und die wilde Mani« bietet Annette Kappenberger von Holidays on Bike an. www.holidays-on-bike.de
- Wandern: Zuverlässig und sympathisch: Ervin Witowschi und seine Frau Tina Tsapatsari von »Experience Nature« bieten für die gesamte Mani geführte Wander- und Klettertouren je nach Fitness und Zeit. Tel. 0030-694-732 55 86, www.experiencenature.gr
- Scooter zur Miete bei: Moto Steki in Stoupa, nahe Kardamili. Tel. 0030-693-402 91 70, www.motosteki.com
- Strandtage: Der Delfinia- Strand war mein Favorit unter den Buchten der Mani. Man muss lediglich der Beschilderung zum Parkplatz folgen, dann kurz einen Steig bergab durch Grün gehen, vorbei an einem Imbisswagen, und danach ab ins Wasser! Delfinia-Strand, zwischen Kardamili und Stoupa

Rau wie ihre Natur ist die Geschichte der Mani, die das bis zu 2407 Meter hohe Taygetos-Gebirge weitgehend gegen den übrigen Peloponnes abriegelt: Bis ins 20. Jahrhundert hinein herrschte in dieser Gegend das Gesetz der Blutrache, Familien bekämpften einander in endlosen Fehden. Steinerne und fast fensterlose Wohntürme, bis zu 20 Meter hoch, zeugen aber auch von einer unbeugsamen Region, die als einzige in Griechenland nie länger von fremden Mächten beherrscht wurde.
Losgewandert sind wir frühmorgens, als die Sonne gerade hinter den Bergspitzen hervorlugte. Unser Startpunkt war Limeni, wo wir am Tag zuvor ins türkisblaue, noch badewarme Wasser gesprungen waren. Wo wir den Fischern zugesehen hatten, wie sie heimkamen vom Meer, und bei »Tákis« anlegten, der Fischtaverne. Man sitzt dort fast im Wasser, der Fisch wird schlicht zubereitet und so schmeckt er auch: schlicht köstlich. Mit Ervin steige ich nun den schmalen Pfad hinauf zur Festung Keléfa. Er geht voraus, schiebt wuchernde Vegetation mit einem Stock zur Seite, zeigt auf einen Schmetterling, auf Heidekraut. Keléfa, umgeben von wuchtigen Findlingen, wurde vor über 300 Jahren erbaut, von den Türken, die damit die widerspenstigen Manioten unter ihre Kontrolle bringen wollten – erfolglos wie gesagt. Erhalten sind noch Mauern und Rundtürme. Die Legende will es, dass Keléfa schon viel früher existiert haben soll, im 13. Jahrhundert, von den Franken errichtet, als Bollwerk und Herzstück der Mani, das glitzernde Meer mit seinen oft unzugänglichen Küsten zu Füßen.
Wiesenschaumkraut wogt beim Anstieg um uns, ein Salamander nimmt Reißaus.
Wo Sie auf der Mani besten essen können
- Lela's Taverna: »Kleinod« ist ein überfrachtetes Wort. Hier aber passt es: Maria Malliri und Giorgos Giannakeas servieren am Wasser griechische Küche zum Dahinschmelzen. Wein umrankt die drei stilvollen Gästezimmer mit Balkon (DZ ab 40 € pro Nacht). Etwas außerhalb steht ihre rustikal-gediegene Apartmentanlage »Notos« (Studio ab 80 €). Tel. 0030-272-107 35 41, www.lelastaverna.com. Apartment Tel. 0030-272-107 37 30, www.notoshotel.gr
- Tákis: Frischer kann Fisch nicht sein. Meine Rotbarbe suchte ich mir gleich am Boot aus. Das lauschige Lokal steht an der Bucht von Limeni. Tel. 0030-273-305 13 27
- Ippocambus: Füße im Wasser, auf dem Tisch selbst gemachte Zucchinichips: Am südlichen Ende der Mani habe ich verstanden, was griechisches Strandleben heißt. Im winzigen Ort Porto Kagio kochen Kostas und Gianna deftig-lecker direkt an der Bucht. Tel. 0030-694-471 04 82

Die Vegetation hier erinnert mich an einen legendären Ort, den ich ein paar Tage vorher besucht hatte – und den schon Homer in der »Ilias« erwähnt: Kardamili. Der britische Reiseschriftsteller und Ex-Agent Sir Patrick Leigh Fermor pries diese Gegend denn auch als »elysische Gefilde«. Als Liebhaber der Mani lebte er jahrzehntelang bis zu seinem Tod 2011 in einem selbst entworfenen Anwesen, unweit des Meeres. Zu seinen Gästen gehörte auch der Autor Bruce Chatwin. Dessen Asche wurde 1989 nahe Kardamili vergraben.
Zu Fuß war ich auch in Kardamili unterwegs, vor allem, um eine der vielen, leider oft verfallenen byzantinischen Kirchen der Mani zu sehen: die Agia Sophia, auf einem flachen Felskegel oberhalb des Ortes gelegen und umgeben von immergrünen, der Spätsommerhitze trotzenden Johannisbrotbäumen. Erreicht habe ich das Kirchlein in Begleitung eines Hirtenhunds, der friedlich vor mir herlief. Ein Hirtenhund, graustruppig und mit kecker Schnauze, ist es auch, der wenige Tage später unsere Wandergruppe von der Festung Keléfa hin zum gleichnamigen Örtchen begleitet. Die Morgensonne strahlt den verschlafenen winzigen Dorfplatz an, irgendwo kräht milde ein Hahn. Und ich lausche dem leisen Glück der Nachsaison.
Die besten Adressen zum Schlafen auf der Mani
- Hotel Annìska & Liakotò: Traditionshotellerie am Messenischen Golf. Ilia und Geraldine Paliatseas bieten praktische Selbstversorgerstudios. Pool und Privateinstieg ins Meer! Tel. 0030-272-107 36 01, www.Anniska-Liakoto.com, ab 80 € pro Nacht
- Areos Polis: Lässiges Boutiquehotel in traditioneller Steinbauweise. Farblich stimmige, geräumige Zimmer. Maria an der Rezeption ist ein wandelndes Mani-Lexikon. Plateia Athanaton, Tel. 0030-273-305 17 87, www.areospolis.gr, DZ/F ab 60€
- Marmari Paradise: Gleich vorweg: Paradies stimmt! Jorgos Georgariou war mal Baunehmer, ist jetzt Pope und hat über einer der raren Sandbuchten der Mani im kleinen Ort Marmari ganz im Süden ein gemütlich-stilvolles Gästehaus errichtet. Am Wochenende geht der Pope oft baden: Dann tauft oder verheiratet er angereiste Gäste bei Sonnenuntergang im Meer. Großes Kino! Seine Taverne ist übrigens auch großartig, etwa der geröstete Käse mit Feigenmarmelade. Tel. 0030-273-305 21 01, www.marmariparadise.gr, DZ/F ab 60€