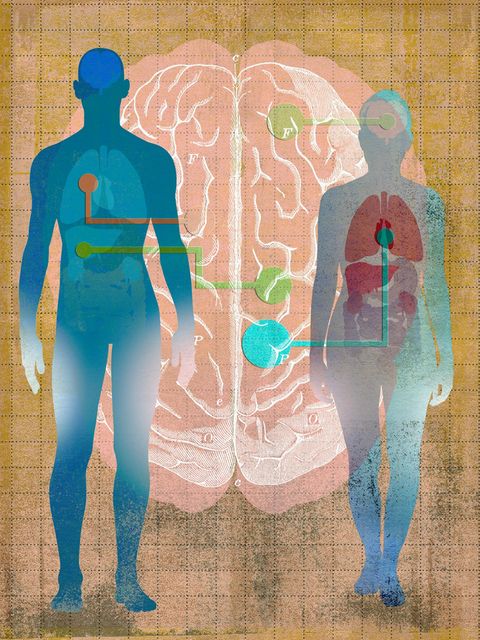Im Alltag hat die Landkarte längst ausgedient. Zu Recht, war sie doch schrecklich unhandlich und ständig verknittert. Niemals ließ sie sich widerstandslos in ihre Ausgangsstellung zurückfalten, und ausgerechnet das Dörfchen, das man ansteuerte, lag stets knapp außerhalb des verzeichneten Gebiets.
Zu mächtig wurde außerdem ihre Konkurrenz. Outdoor-Uhren, die mit bunten Pfeilen den Weg weisen. GPS-Geräte, die beinahe überall auf der Erde Satellitensignale empfangen. Und dann ist da noch der Alleskönner Smartphone, ohnehin in jeder Tasche.
Unschlagbar blieb die Landkarte trotzdem. Sie hat weder einen Bildschirm, der splittern kann, noch einen Akku, der plötzlich aufgibt. Sie ist nicht angewiesen auf einen Signalempfänger, der immer dann streikt, wenn man ihn am dringendsten benötigt. Sie ist um ein Vielfaches genauer als die meisten Outdoor-Apps.
In Kombination mit einem Kompass ist eine Karte aus Papier noch immer unverzichtbar für all jene, die Landschaften auf unbekannten Pfaden erkunden. Vorausgesetzt, man weiß sie zu lesen.
Welche Informationen stehen auf einer Karte?
Auf topografischen Karten sind stets Höhenlinien verzeichnet. Jede einzelne markiert eine exakt definierte Höhe über dem Meeresspiegel, zusammen zeichnen sie ein Bild der Landschaft. Sitzen die Höhenlinien dicht beieinander, ist der Hang steil. Sind die Abstände groß, ist das Gelände flach.
Mindestens ebenso wichtig sind die Farben der Flächen. Dunkles Grün steht meist für dichten Wald, hellere Töne für mit Büschen und Sträuchern bewachsene Bereiche. Das jedoch ist von Karte zu Karte verschieden. Entscheidend ist die Legende: Bevor man also mit Karte und Kompass loszieht, sollte sie studiert werden. Sonst ist die erwartete Heidelandschaft plötzlich ein modriger Sumpf. Auch der Maßstab ist entscheidend. Für Wanderungen im weglosen Gelände haben sich topografische Karten im Maßstab 1:25.000 oder 1:50.000 bewährt.
Landkarten sind fast immer nach Gitternord ausgerichtet: an gedachten Linien, die sich am Koordinatensystem orientieren, mit denen auch die meisten GPS-Geräte funktionieren. Eine Kompassnadel hingegen richtet sich nach der Magnetachse der Erde, zeigt auf den magnetischen Nordpol. Je weiter nördlich man sich befindet, desto gravierender wird dieser Unterschied. In unseren Breitengraden ist er jedoch irrelevant für eine grobe Orientierung.
Orientierung mit dem Kompass: Woher weiß ich, wo ich bin?
Ohne markante Punkte in der Umgebung beim Namen zu kennen, ist jede Karte nutzlos. Wer sich selbst verorten möchte, braucht zwei davon: einen Berg, einen Wasserfall, einen Passübergang. Mithilfe eines Kompasses kann nun der Richtungswinkel bestimmt werden. Dafür muss das "Visier", meist eine kleine Einkerbung am oberen Ende des Gehäuses, auf den markanten Punkt ausgerichtet werden.
Ein Kompass hat eine Anlegekante, diese muss nun auf den bekannten Punkt auf der Karte gelegt werden. Die Nordstriche des Kompasses müssen dabei parallel zur Gitterlinie der verlaufen. Dann kann ein Strich an der Anlegekante gezogen werden.
Denselben Vorgang wiederholt man mit einem zweiten Punkt. Im Idealfall liegt dieser, vom eigenen Standort aus betrachtet, ungefähr in einem 90-Grad-Winkel zum ersten. Wieder wird eine Linie gezogen, und wo die beiden Striche sich kreuzen, befindet sich der eigene Standort. Rückwärtseinschneiden heißt diese Methode. Doch Vorsicht: Sobald es heikel wird, gleicht ein Berg dem anderen, lässt sich kaum ein markanter Punkt am Horizont entdecken. Outdoor-Profis verorten sich deshalb ständig selbst, blicken lieber einmal zu oft auf die Karte.
Marschrichtung bestimmen: Woher weiß ich, wohin ich gehen muss?
Wer um den eigenen Standort weiß und ein bekanntes Ziel ansteuert, kann dorthin ebenfalls mit Kompass und Karte gelangen: per Vorwärtseinschneiden. Dafür legt man den Kompass auf die Karte. Die Anlegeseite läuft dabei durch beide Punkte, den eigenen Standort und das Ziel. Nun muss die Kompassdose, das Herzstück des Kompasses, so ausgerichtet werden, dass die darauf verzeichneten Gitterlinien parallel zu denen der Karte verlaufen.
Oberhalb der Kompassdose befindet sich üblicherweise ein kleiner Zeiger, auf "zwölf Uhr". An diesem lässt sich nun die Marschrichtung in Grad ablesen: auch Marschkompasszahl genannt. Diese kann auf die Karte abgetragen werden und als Orientierung dienen.
Die Karte kann aber auch im Rucksack verschwinden, der Kompass reicht nun zur Orientierung. Dessen Dose bleibt dafür unverändert eingestellt, der kleine Zeiger oberhalb gibt die Richtung vor. Dabei muss die Magnetnadel des Kompasses jedoch stets im vorgefertigten Raster stehen. Vorsicht: Damit die Nadel sich zuverlässig gen Norden ausrichtet, muss der Kompass einigermaßen horizontal gehalten werden. Auch Stromleitungen oder große Bauwerke aus Stahl, Brücken etwa, können stören.
Himmelsrichtung bestimmen: Wie orientiere ich mich mit Uhr und Sonne?
Wer weder Kompass noch Landkarte zur Hand hat, kann zumindest die Himmelsrichtung bestimmen. Vorausgesetzt, er oder sie trägt eine Armbanduhr und die Sonne scheint. Die Uhr wird so ausgerichtet, dass ihr Stundenzeiger auf die Sonne zeigt. Entscheidend ist der Winkel zwischen ihm und der auf der Uhr verzeichneten Zwölf. Dabei ist es wichtig, dass immer der weniger weite Winkel genutzt wird. Am Vormittag also von Stundenzeiger zu Zwölf, am Nachmittag von Zwölf zu Stundenzeiger.
Dieser Winkel wird nun halbiert, die Mittellinie zeigt Richtung Süden. Achtung: Herrscht Sommerzeit, muss der Stundenzeiger eine Stunde zurückgestellt werden.