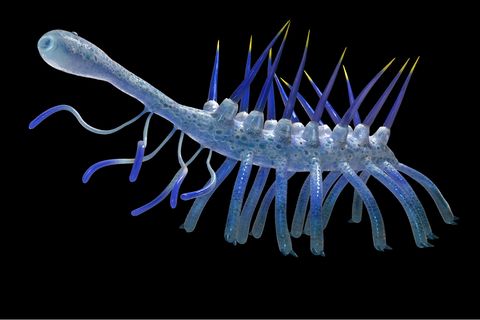Heimisch sind Flusspferde einzig in Afrika südlich der Sahara. Doch in den vergangenen drei Jahrzehnten haben sie sich in Kolumbien ausgebreitet. 1981 hatte der Drogenboss Pablo Escobar drei weibliche Flusspferde und ein männliches gekauft und für seinen Privatzoo illegal nach Südamerika bringen lassen. Nach seinem Tod 1993 verfiel der Zoo, die Tiere büchsten aus und machen sich seitdem im Einzugsgebiet des Río Magdalena breit.
Ohne natürliche Feinde vermehren sich die Tiere der Art Hippopotamus amphibius seitdem unkontrolliert im fremden Ökosystem. Die Fortpflanzung der Tiere abschätzend, vermuteten Forschende bislang, dass 2020 etwa 98 Exemplare die Region bevölkerten. Doch eine aktuelle Zählung offenbart, dass das Problem weit unterschätzt wurde. Demnach tummeln sich mehr als doppelt so viele Flusspferde im Rio Magdalena und in den Nebenflüssen: zwischen 181 und 215 Exemplare.
Obwohl die Flusspferde dank ihres stattlichen Körperbaus als größte invasive Tierart der Welt gelten, ist es gar nicht so leicht, die Tiere zu finden und zu zählen: Sie sind nachtaktiv, tauchen 16 Stunden am Tag ins Wasser ein und wandern über große Entfernungen.
Zwei Jahre lang erkundete daher ein Team der Universidad Nacional de Colombia und des Instituto Humboldt das Gebiet auf mehreren Reisen – per Auto, Boot oder zu Fuß. Um die Tiere zu zählen, setzten sie zudem Drohnen ein. Aus direkter Beobachtung, aber auch indem sie Fußspuren dokumentierten, schlossen sie auf die Größe der Population.
Beobachtungen sind besorgniserregend
Besorgniserregend ist ihre Beobachtung, dass enorme 37 Prozent der Exemplare Jungtiere sind. Dies belegt, wie schnell sich die Tiere vermehren. Tatsächlich sind die Lebensbedingungen in Kolumbien für die Kolosse paradiesisch. Keine natürlichen Fressfeinde, keine Dürreperioden wie in Afrika, keine internen Kämpfe um Territorien und Nahrung. Womöglich werden die Flusspferde unter diesen Bedingungen früher geschlechtsreif. "Die Studie zeigt, dass es sich um ein reales Problem handelt und dass der Staat dringend handeln muss", sagt der Ökologe Rafael Moreno vom Instituto Humboldt in Bogotá.
Denn das Team dokumentierte auch, wie die Tiere der heimischen Flora und Fauna schaden. Mit ihren bis zu drei Tonnen Gewicht lassen sie die Flussufer erodieren, ihre massigen Körpern schlagen Furchen durch die Wälder. Die Flusspferde besetzen den Lebensraum anderer Tiere und machen ihnen Ressourcen streitig. Ökologinnen und Ökologen fürchten daher, die Flusspferde könnten heimische Arten wie den Nagel-Manati (Trichechus manatus), den Südamerikanischen Fischotter (Lontra longicaudis) und das Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) verdrängen. Auch sollen die Flusspferde Menschen angreifen, etwa Fischer, gegen die die Tiere ihr neugewonnenes Territorium aggressiv verteidigen.
Kot der Flusspferde überdüngt die Flüsse
Wie die invasive Art das Ökosystem auch auf subtilere Weise verändert, zeigt eine Studie der University of California San Diego 2020. Demnach überdüngen die Tiere mit ihrem Kot die Flüsse. Nachts grasen die Tiere an Land, tagsüber kühlen sie sich im Wasser und entleeren sich oft dort. Dadurch bringen sie Nährstoffe vom Land ins Wasser, welche von Algen und Bakterien verarbeitet werden. Dies wiederum kann den Sauerstoffgehalt im Wasser senken. Einige Forschende fürchten, dass das aquatische Ökosystem kippt. Andere Forschende halten jedoch dagegen, dass die Nährstoffzufuhr sogar für mehr Artenvielfalt in den Gewässern sorgen könnte.
Um die Population der Flusspferde zu reduzieren, erproben Forschungsteams, Verhütungsmitteln per Pfeil an die Tiere zu verabreichen. Doch die Methode ist langsam und kostspielig. Laut einer Studie, veröffentlicht im April, ließen sich auf diese Weise die Flusspferde erst in 45 Jahren ausrotten, bei Kosten von mindestens 850.000 US-Dollar. Diese Rechnung basierte allerdings noch auf der früheren Schätzung der Populationsgröße.
Alternativ ließen sich die Tiere einfangen, betäuben und per Hubschrauber zu einer Kastrationseinrichtung transportieren. Hier prognostizierte die Studie bei der früheren Populationsgröße eine Ausrottung in bis zu 52 Jahren, bei Kosten von immer noch 530.000 US-Dollar. Kastration und Sterilisation schützen zudem Menschen nicht vor Angriffen. Mehrere Zoos wiederum haben abgewunken, die Tiere aufzunehmen, und aufgrund der größeren Zahl ist diese Möglichkeit noch unwahrscheinlicher geworden.
Escobars Flusspferde sind eine Touristenattraktion
Angesichts der Schäden befürworten einige Forschende daher eine drastische Maßnahme: die Keulung aller Tiere. Anders ließe sich das Problem kaum kostengünstig und schnell lösen, bevor sich die Ausbreitung der Tiere in Kolumbien gar nicht mehr kontrollieren ließe. Zwar sei die Tötung der Tiere radikal, doch wichtiger sei es, die Flora und Fauna Kolumbiens zu schützen, dem Land mit der zweitgrößten Artenvielfalt der Welt.
"Die Entscheidung, ein Nilpferd zu töten, hat ein moralisches Gewicht. Aber das Gewicht der anderen Entscheidung - Untätigkeit - ist viel größer", sagt Moreno. "Ich hoffe, dass die Politiker dies verstehen werden". Allerdings: Auch einige Einheimische sind gegen die Tötung der Tiere, die zur Touristenattraktion wurden.
Und so kommt es zu einer paradox wirkenden Situation: In Südamerika fordern Forschende die Ausrottung der Flusspferde, während die Tierart in Afrika beschützt werden muss. Dort, wo Menschen ihren Lebensraum weiterhin zerstören und die Tiere auch aufgrund ihrer Zähne bejagen, leben schätzungsweise 115.000 bis 130.000 Exemplare. Die Flusspferde gelten damit offiziell als gefährdete Tierart.