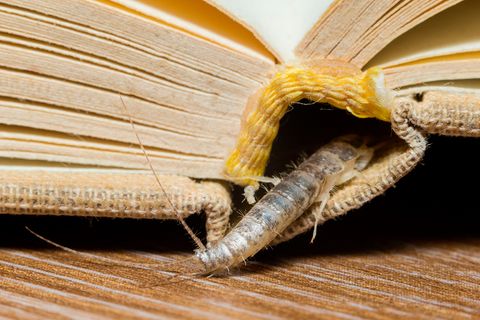Die Sonne leuchtet den Weg
Wandernde Tiere sind uns nicht unbekannt. Wir wissen von Zugvögeln, die im Extremfall von der Arktis in die Antarktis fliegen. Wir lesen von Fledermäusen, die Hunderte von Kilometern ins Winterquartier ziehen, und von Walen, die von Ozean zu Ozean tauchen. Aber dass Schmetterlinge, filigrane Flugobjekte mit Miniaturmuskeln, ganz vorn unter den Marathon- Weltmeistern mitmischen, ist wohl doch noch immer eine Überraschung.
Den Superlativ der Superlative schafft eine orange-schwarze Schönheit: Der Zug des nordamerikanischen Monarchfalters überspannt bis zu 4000 Kilometer Nord- und Mittelamerikas. Ein einzelner Falter, der sich irgendwo vom Ufer der Großen Seen Mitte September zum Transkontinentalflug aufschwingt, durchmisst - im Pulk oder als Einzelkämpfer - den ganzen Mittleren Westen und die staubtrockenen Südweststaaten der USA, um dann nach durchschnittlich 75 Kilometern pro Tag sein gebirgiges Winterquartier in Zentralmexiko zu erreichen. Mit einer Punktlandung in einem etwa 1000 Quadratkilometer kleinen Zielgebiet - das ist die Fläche der Insel Rügen.
Die Sonne leuchtet den Weg
Wie ist das möglich? Wie orientiert sich dieser Überflieger, den der US-Kongress sogar einmal als "National Insect of the USA" vorgeschlagen hat? Einer, der sich dem inneren Kompass von Danaus plexippus mit Akribie widmet, ist Orley Taylor vom Monarch-Forschungsprojekt der Universität Kansas. Die erste Arbeitshypothese des Professors lag nahe: Er hatte die Sonne als Richtungsgeber im Verdacht. Um dies zu prüfen, verfrachtete er Hunderte Monarchen auf Südkurs von Kansas, der geografischen Mitte der Vereinigten Staaten, nach Washington, D. C., an die Ostküste. Jene Exemplare, die er dort umgehend wieder freiließ, orientierten sich südwärts, gerade so, als hätte kein Ortswechsel stattgefunden: Sie flogen auf einem Kurs, der sie auf die Halbinsel Floridas geführt hätte und nicht nach Mexiko. Sobald Taylor seine Testflieger nach der Verschickung an die Atlantikküste ein paar Tage hinter Fliegengitter gefangen hielt - und zwar so, dass sie Sonnenaufgänge und -untergänge erleben konnten -, orientierten sie sich neu. Und zwar richtig! Sie wählten eine Route, die es ihnen erlaubte, wieder das ursprüngliche Ziel anzuvisieren. Die Sonne leuchtet ihnen offenbar den Weg.
Magnetfeld der Erde spielt eine Rolle bei der Navigation
Aber auf welche Weise? Zumindest verfügt Danaus plexippus über ein Protein, das Sonnenkompass und eine "innere Uhr" miteinander verbindet, so jüngste Erkenntnisse des Neurobiologen Steven Reppert von der Universität von Massachusetts. Damit könne der Falter einen gradlinigen Kurs halten, obwohl sich der Sonnenstand ändert. Doch wie wird daraus ein verlässlicher Wegweiser zu einem zuvor unbekannten Ziel? Auch war mit Taylors Sonnenlicht-Experiment keineswegs bewiesen, dass nicht noch etwas anderes, etwa das Magnetfeld der Erde, eine Rolle spielt, zumal die Tiere sogar bei bedecktem Himmel Kurs halten können. Und in der Tat enthüllten Orley Taylor und andere Forscher, dass auch die magnetischen Feldlinien eine zentrale Bedeutung haben. Dafür wurden herbstwandernde Monarchen unter dreierlei Bedingungen getestet: Sie waren normalen Gegebenheiten ausgesetzt, dann einem künstlich umgepolten Magnetfeld und schließlich totaler Abschottung von magnetischen Einflüssen.
Bei fehlenden magnetischen Einflüssen zeigen sich die Monarchen desorientiert
Die Ergebnisse waren so, wie man sie sich klarer nicht hätte wünschen können: Bei natürlichen, unveränderten Bedingungen taten wandernde Monarchen das, was sie immer tun: Sie orientierten sich südwestwärts. Bei künstlicher Umpolung des Magnetfelds gingen sie exakt auf Gegenkurs: nordostwärts. Und bei experimentell abgeschotteten - also fehlenden - magnetischen Einflüssen zeigten sich die Monarchen gänzlich desorientiert. Die Resultate von Sonnenlicht- und Magnetismus-Test zusammen ergeben für den Monarchfalter so etwas wie ein Doppel-Leitsystem. Das ist wundersam, aber nicht unvorstellbar: Aus der Vogelzug-Forschung ist bekannt, dass Weitzieher sowohl das Magnetfeld als auch die Himmelskörper als Orientierungssysteme verwenden. Aber Vögel haben ein Gehirn, und sei es nur ein knapp haselnussgroßer Minicomputer. Schmetterlingen dagegen steht nur ein Quasi-Gehirn zur Verfügung, ein winziges Paar Nervenknoten. Und doch schaffen sie ein paar Dinge, die Superhirnträger nicht können.
Zigmillionen Flügel und Leiber
Die meisten Weitwanderer erreichen Mitte November ihr Ziel: die bis auf 3600 Meter aufragenden Bergflanken des mexikanischen Michoacán-Hochlands nahe dem Städtchen Angangueo. Von schrundiger, brauner Haut überzogen, spannen sich die Berge bis zum Horizont. Baumfällerkolonnen haben dem Land schon große Teile des Waldkleids vom Leib gerissen, aber noch heben sich von den verdorrten Grasfluren und Kleinfeldern die sattgrünen Kapuzen aus Oyameltannen ab. Noch sind einige Bergspitzen zu unwegsam für Holzlastwagen.
Wer diesen Fleck der Erde im Winter erreicht, steht vor einem weiteren großen Monarchfalter-Rätsel: Weshalb ballen sich die Weitwanderer winters zu Abermillionen gerade an den Oyameltannen - und zwar fast ausschließlich an diesen? Ein gigantischer pulsierender Organismus aus Zigmillionen Flügeln und Leibern überwölbt Borke und Zweige. Haben die Koniferen eine Ausdünstung, die unwiderstehlich oder gar überlebenswichtig ist? Für menschliche Nasen riecht es in den Hochlandwäldern einfach nur so wie in mediterranen Pinienwäldern: würzig, herb, kräftig. Oder bietet vielleicht die Borke ein Mikroklima, das für die Monarchen exzellent und so einmalig ist, dass sich ein 4000 Kilometer langer Anflug lohnt?
Feuchtigkeit und Kälte vereinen sich zum tödlichen Doppelschlag
Den sie allerdings längst nicht immer überleben. Für das Jahr 2002 etwa schätzten Experten die Zahl der Überwinterer auf mehrere Hundert Millionen Exemplare. Doch Mitte Januar wurden dann zwei der größeren Kolonien in über 3000 Meter Höhe von einer Kaltfront, die in den frühen Morgenstunden rasch durchzog, zu 75 Prozent ausgelöscht; Feuchtigkeit und Kälte vereinten sich zum tödlichen Doppelschlag. Der Waldboden unter den Koniferen färbte sich orangerot. Der Mensch, der dezimeterdicke Schichten toter Falter unter den Stämmen sieht, beginnt unwillkürlich zu zweifeln: Wie kann etwas, das so viele Opfer fordert, eine Erfolgsstrategie der Evolution sein? Ist denn ein Winter in mehr als 3000 Meter Höhe mit gelegentlichen Schnee-Attacken und periodisch wiederkehrender, gefährlich kalter Nässe so viel günstiger als ein Winter am Rand der Großen Seen, entlang der Grenze von USA und Kanada? Es muss einen Grund für die Mexikoreise der Monarchfalter geben, den Wissenschaftler noch nicht gefunden haben. Einen Grund, der für die Schmetterlingspopulationen wichtiger ist, als es Verluste in Millionenhöhe sind.
Falter, die den Gebirgswinter in Mittelmexiko überlebt haben, brechen im März zur Rückreise auf. Entweder haben die betagten Weibchen dann schon männliches Sperma in der Vorratssamentasche - befruchtet werden die rund 400 Eier erst unmittelbar vor der Ablage -, oder die erste Etappe des Rückflugs wird zur Hochzeitsreise. Während der flatterhafte Trail gen Mexiko und die Überwinterung die Aufgaben einer einzigen langlebigen Generation sind, gestaltet sich die Rückkehr generationenübergreifend. Drei bis vier kurzlebige Retour-Flug-Generationen orientieren sich nordostwärts, wobei die Koordinaten des Flugziels offenbar jeweils über die vier Entwicklungszyklen (Ei/Raupe/Puppe/Falter) weitergegeben werden. Und genau das gilt als weiteres Unterkapitel zum Thema Monarchwunder: Keine andere Insektenart hat Wanderzyklen, die sich über mehrere Generationen erstrecken und zugleich einen geschlossenen Kreis beschreiben.
Der Schutz der Selbstvergiftung
Denn die Ur-Ur-Enkel landen in etwa dort, wo die Ahnin zehn oder elf Monate zuvor aufgebrochen ist. Und noch eine Besonderheit: Wo in der Tierwelt große Wanderzüge unterwegs sind, seien es nun Makrelen im Meer oder Gnus in der Savanne, konzentrieren sich die Jäger. Müssten da die fliegenden Eiweißteppiche nicht von allerlei Spezialisten Bissen für Bissen aufgezehrt werden? Die Mahlzeit würde Räubern schlecht bekommen: Monarchfalter beherrschen nämlich, wie zum Beispiel auch die Widderchen (Blutströpfchen), die Kunst der schützenden Selbstvergiftung. Das, womit die Raupen des Monarchen sich beim Verzehr ihrer Exklusiv-Speise, der Blätter von Schwalbenwurzgewächsen, imprägnieren, nennen Chemiker Cardenolide: an Zuckermoleküle gebundene Substanzen, wie sie sich auch im giftigen Fingerhut oder in der Haut mancher Kröten finden. Die orange-schwarze Warntracht der Monarchen hilft optisch orientierten Jägern, die einmal einen unbekömmlichen Biss getan haben, sich das Aussehen des Ekelhappens zu merken und künftig Abstand zu halten.
Das fettreiche Hinterteil der Monarchen
Allerdings gilt dieses Stoppschild nicht für alle Beutemacher. Wer über die nötigen Verdauungssäfte verfügt, dem bedeutet das Orange der Monarchen nicht Warnung, sondern eher Verheißung. Zu diesen Spezialisten zählen (neben einer Mäuseart) zwei Vogelarten: Schwarzkopf-Kernknacker und Schwarzrückentrupial. Die Kernknacker verzehren das fettreiche Hinterteil der Monarchen und ertragen die Giftladung - irgendwie. Die Trupiale schlitzen den Schmetterlingsleib mit ihren scharfen Schnäbeln auf und schaffen es, Brustpartie und Hinterteil mit der Zunge auszulecken. Dabei umgehen sie vielleicht die besonders giftigen Stellen.
Der Catering-Service für Monarchraupen
Diese wenigen Feinde können das Millionenheer der Monarchie natürlich nicht ernsthaft bedrohen. Gefahr kommt von anderer Seite. Wissenschaftler der Universitäten Kansas und Minnesota vermuten, dass Monarchen zu den ersten massenhaften Klima-Opfern der kommenden Jahre zählen werden. Der globale Klimawandel, so ihre Prognosen, wird den mexikanischen Überwinterungsgebieten mehr Niederschläge und Sturm bringen. Schlecht für die Wintergäste; sie können zwar erstaunlich viel trockene Kälte ertragen, nicht aber nasskalte Stürme.
Eine zweite Gefahr für die Falter, nämlich die, dass im corn belt des Mittleren Westens Maispollen von genmanipulierter Feldfrucht auf Monarch-Futterpflanzen abweht und so die Wanderzüge dezimiert, wird zwar nach eingehenden Untersuchungen für gering gehalten. Aber unmittelbar bedrohlich ist etwas anderes: die Verdrängung der für die Raupen lebenswichtigen Schwalbenwurzgewächse durch intensiven Maisanbau.
Orley Taylor von der Universität Kansas hat, um Engpässe zu vermeiden, eine Art Catering-Service für Monarchraupen entwickelt: Er verschickt in alle Bundesstaaten Packungen mit "Unkraut"- Samen für exklusive Futterplätze. Innerhalb eines Sommers ist es ihm gelungen, fast 1000 dieser Fress-Stationen in privaten Gärten, an Golfplätzen und Schulhöfen einrichten zu lassen.
Umweltfreunde hoffen sogar, der Falter in der eleganten Fluguniform könnte helfen, den Naturschutzgedanken generell zu verbreiten. Populär genug ist er: Im ganzen Land finden tagging events statt, in deren Verlauf Kinder und Erwachsene die Möglichkeit haben, Monarchfalter zu markieren (to tag) und später im Internet zu verfolgen, wo und wann "ihr" Schmetterling gefunden wird. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 15.000 Menschen dabei mitgemacht.
Nomaden des Windes - Der Zug der Monarchfalter und andere Schmetterlingswunder: Claus-Peter Lieckfeld (Autor) und Ingo Arndt (Fotograf), 192 Seiten, 100 Farbfotos, Frederking & Thaler Verlag in Kooperation mit GEO, ISBN 978-3894057091, 39,90 Euro