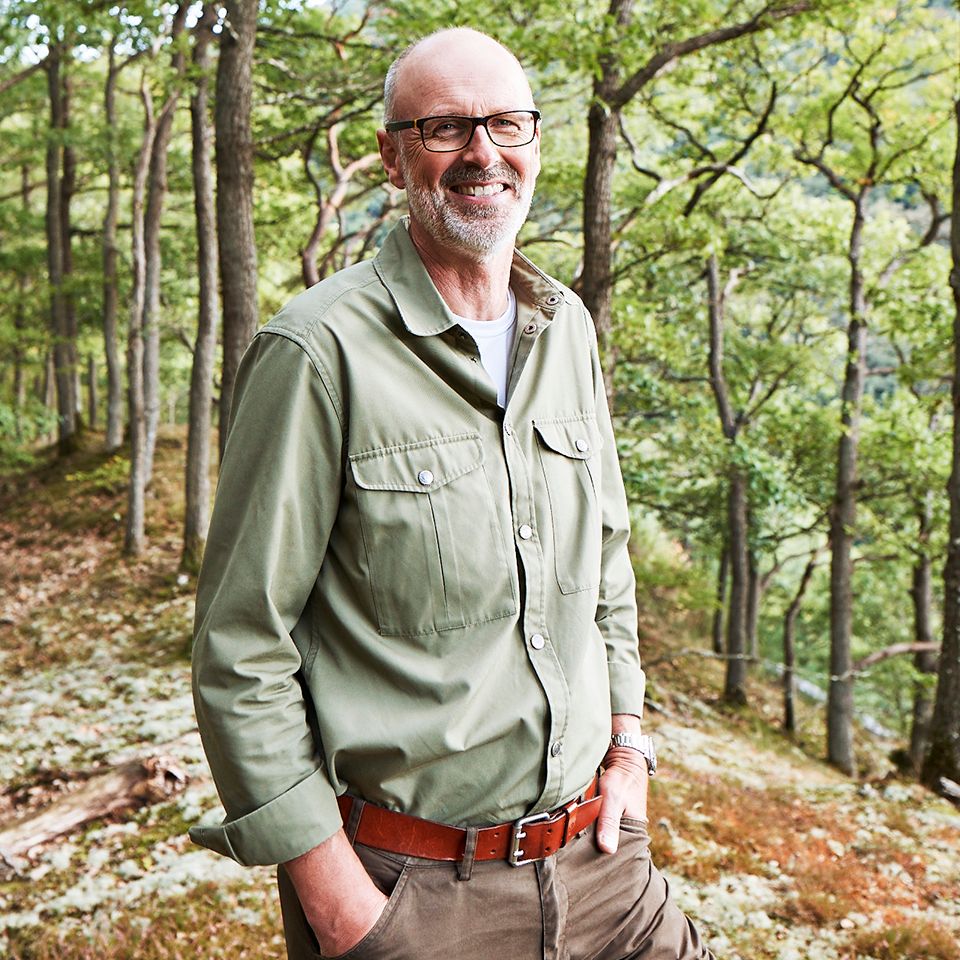Die Schäden am deutschen Wald sind so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Mittwoch veröffentlichte: Von 245.000 Hektar toter Waldfläche in Deutschland geht das Ministerium für das Jahr 2020 aus. Im Herbst 2019 beliefen sich die Schätzungen noch auf rund 180.000 Quadratmeter. Besonders betroffen sind Nordrhein-Westfalen (68.000 Hektar), Thüringen (rund 30.000 Hektar), Niedersachsen (26.280 Hektar) sowie Hessen (26.100 Hektar).
Als Hauptgründe für die große Fläche an abgestorbenem Wald sieht das BMEL "Stürme, die extreme Dürre, Waldbrände und den Borkenkäferbefall".
Experten sehen heute vor allem den Sturm Frederike im Januar 2018 als Startpunkt für die rasende Verbreitung des Borkenkäfers. Damals wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, Sturmholz lag lange in den Wäldern, ein Paradies für die Käfer. Die Dürren in den darauf folgenden Sommern schwächten die Waldbestände und verhinderten, dass sie sich erfolgreich gegen den Befall zur Wehr setzten.
Nur Mischwälder bringen nachhaltige Lösungen für den deutschen Wald
Für Ulrich Dohle, Vorsitzender des Bundes für Deutsche Forstleute, sind die aktuellen Zahlen nur das Symptom tief greifender struktureller Probleme - zum einen in der Personaldecke der Förster, zum anderen in der Struktur der deutschen Wälder selbst. "Wir sind schlichtweg zu wenige, um der Lage Herr zu werden. Eigentlich betreiben wir seit zwei Jahren Krisenmanagement, nach den vielen Einsparungen in den letzten Jahrzehnten sind wir darauf nicht ausgelegt", klagt er. Eigentlich sollten die Förster den abgestorbenen Wald wieder aufforsten, sie schaffen es jedoch kaum, das Totholz aus dem Wald zu schaffen, um die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern.
Meist sind es Fichten, die der Dürre, den Borkenkäfern oder Stürmen nicht standhalten. Diese Monokulturen dominieren die deutsche Waldfläche, machen 55 Prozent aus. Was einst für eine schnelle Wiederaufforstung sorgte, wird jetzt zum Problem: Die Nadelbäume halten den erschwerten Bedingungen, die der Klimawandel mit sich bringt, weit weniger schlecht stand als ein Laub- oder Mischwald.
Hinzu kommt: Die Fichtenpopulationen verjüngen ihre Bestände oftmals von selbst, wo Bäume absterben, sprießen schnell neue Jungbäume aus dem Boden. Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, wäre es wichtig, Laubbäume aktiv zu pflanzen, sagt Dohle. "Uns fällt jetzt der verpasste Umbau der letzten Jahrzehnte auf die Füße. Wenn wir so weitermachen wie bisher, bräuchten wir allein 120 Jahre, um die strukturärmsten Monokulturen in Deutschland umzubauen. So viel Zeit lässt uns der Klimawandel aber nicht."
Und auch der Winter hat kaum Entspannung für die gestressten Baumpopulationen geschaffen: Zu trocken war er, Schnee ist wieder weitestgehend ausgeblieben, so konnte er nicht für eine Erholung der Grundwasservorräte sorgen, die die Böden mit wichtigen Nährstoffen für die Wurzeln der Bäume versorgen.
Auch wenn der Februar überdurchschnittlich feucht war, Grund für Entwarnung sieht Dohl nicht: "Die Schichten unter dem Oberboden sind staubtrocken, das haben die kleineren Stürme in der jüngeren Vergangenheit wieder gezeigt. Wie sich das in diesem Sommer auswirkt, kann man nicht hundertprozentig sagen. Aber die Langzeitfolgen werden gravierend sein."