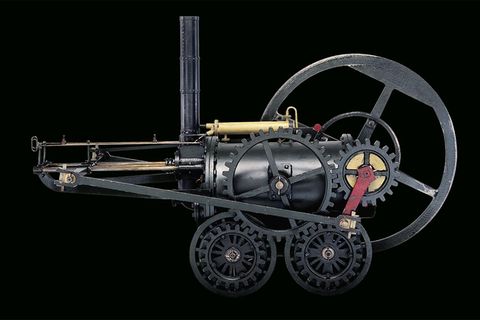Für Ausflügler sowie Pendlerinnen und Pendler war das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer eine große finanzielle Entlastung. Im Mai startet nun der Nachfolger, das Deutschlandticket – angelegt auf Dauer, gedacht als Abo für Millionen Menschen, für zunächst 49 pro Monat. Auch hier gilt ein Einheitspreis für alle Bus- und Bahnfahrten des Nah- und Regionalverkehrs im gesamten Bundesgebiet. Wie viele Menschen mit der neuen Monatskarte dauerhaft auf Busse und Bahnen statt auf das Auto setzen werden, ist noch offen. Profiteure des neuen Angebots lassen sich aber bereits ausmachen. Eine Übersicht:
ÖPNV-Stammkunden
Für sehr viele Pendlerinnen und Pendler, die schon jetzt auf Busse und Bahnen setzen, dürfte das Deutschlandticket künftig der Fahrschein der Wahl sein. Bisher kosten Monatstickets schnell ein Vielfaches im Vergleich zum 49-Euro-Ticket – vor allem, wenn die Arbeitsstätte nicht im Wohnort liegt oder der Arbeitgeber sich nicht an den Kosten beteiligt; selbst dann ist der monatliche Ticketpreis meist deutlich höher.
Mit der Jobticket-Option beim Deutschlandticket könnte es für viele sogar noch günstiger werden als 49 Euro: Wenn der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent der Kosten trägt, geben Bund und Länder weitere 5 Prozent hinzu. So könnte das Abo für manche Pendlerinnen und Pendler nur noch 34,30 Euro kosten.
Dennoch muss das günstigste Angebot nicht für jeden auch das passende sein. Das 49-Euro-Abo bietet im Kern keine Möglichkeiten, andere Menschen kostenfrei mitzunehmen. Zudem ist es personengebunden und nicht übertragbar. Bisherige Monatskarten können an dieser Stelle Vorteile bieten.
Ausflügler
Das auf drei Monate beschränkte 9-Euro-Ticket wurde im vergangenen Sommer von unzähligen Ausflüglern genutzt. Für viele rechnete sich das Monatsticket schon, wenn sie nur an einem Tag zum Bummeln in die nächste Stadt oder zum Wandern in die Natur fahren wollten. Entsprechend voll waren an den Wochenenden viele Züge und Bahnhöfe.
Wie viel Ausflugsverkehr das 49-Euro-Ticket auslösen wird, ist noch unklar. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für die Deutsche Presse-Agentur gaben immerhin 66 Prozent derjenigen, die das Abo bereits gebucht haben, an, dass sie damit auch Freizeitfahrten planten. 54 Prozent wollen das Ticket demnach auch für den Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule nutzen. Weil Mehrfachantworten möglich waren, lässt sich jedoch nicht sagen, welcher Grund nun ausschlaggebend für den Kauf war.
Finanziell lohnt sich ein Ausflug mit dem Deutschlandticket erst bei größeren Entfernungen, Reisen mit Übernachtung oder mehreren Touren pro Monat. Für Tagesausflüge mit dem Nahverkehr gibt es das etwas günstigere Quer-durchs-Land-Ticket, das für 44 Euro bundesweit einen Tag lang gültig ist. Für jeden weiteren Mitfahrer fallen dabei nur jeweils sieben Euro zusätzlich an. Das Deutschlandticket setzt sich im Vergleich je nach Gruppengröße erst durch, wenn eine Übernachtung eingeplant wird – schließlich gilt es auch am nächsten Tag noch.
Dorfbewohner und Städter
Sowohl beim 9-Euro-Ticket als auch beim Nachfolger war und ist ein wesentlicher Kritikpunkt, dass es die ÖPNV-Fahrt zwar günstiger macht, das Angebot aber keineswegs verbessert. Vor allem auf dem Land fühlen sich viele Menschen auf ein Auto angewiesen, weil die Anbindung an Busse und Bahnen häufig schlecht ist. Das zeigt auch die Yougov-Umfrage: 28 Prozent der Befragten, die das Deutschlandticket nicht kaufen wollen, begründeten ihre Entscheidung damit, dass das ÖPNV-Angebot in ihrer Region nicht gut sei.
Interessant ist das Deutschlandticket vor allem für Stadtbewohner und Menschen, die in den sogenannten Speckgürteln um diese Städte herum zu Hause sind. Ähnlich wie das 9-Euro-Ticket könnte das Deutschlandticket aber ein Anreiz sein, sich mit dem bestehenden ÖPNV-Angebot genauer zu beschäftigen.
Fernreisende und Fernpendler
Das Deutschlandticket gilt nicht im Fernverkehr, also weder in ICE- und IC-Zügen oder in den Nachtzügen unterschiedlicher Anbieter. Auch für Flix-Züge und -Busse gilt das Abo nicht. Es kann aber natürlich genutzt werden, um mit dem Nah- und Regionalverkehr zu einem Bahnhof zu kommen, um dort in einen ICE zu steigen.
Dann gilt aber: nicht den Anschluss verpassen. Denn wer aufgrund einer Verspätung im Regionalverkehr mit dem Deutschlandticket einen gebuchten ICE verpasst, hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Aufhebung der Zugbindung. Die Kunden hätten in diesem Fall zwei Beförderungsverträge abgeschlossen, die fahrgastrechtlich separat betrachtet würden, heißt es dazu von der Bahn.
Was bringt das Deutschlandticket dem Klima?
Verbände und Experten sind eher skeptisch. Die Kernaussagen: das Deutschlandticket gehe in die richtige Richtung. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) aber müsse ausgebaut werden. Nötig seien weitere Maßnahmen, damit Pendler vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen.
"Jede Fahrt, bei der das Auto stehen bleibt und stattdessen der ÖPNV genutzt wird, ist gut fürs Klima", sagte Greenpeace-Expertin Marissa Reiserer. "Das 49-Euro-Ticket macht Bus und Bahn deutlich unkomplizierter, zaubert aber keine neuen Bahnhöfe, Haltestellen und Verbindungen aufs Land. Die Einführung kann deswegen nur der Start sein." Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, sagte, ob das Ticket CO2 einspare, müsse sich erst zeigen. Dies wäre dann der Fall, wenn eine merkliche Zahl von Autofahrten durch das Ticket wegfielen: "In welchem Maße das stattfindet, lässt sich aktuell aber noch nicht abschätzen."
Verkehrssektor muss aufholen
Der Verkehr ist eines der großen "Sorgenkinder" beim Klimaschutz. Im vergangenen Jahr wurden gesetzliche Vorgaben zur CO2-Einsparung verfehlt. Die Emissionen stiegen im Vergleich zum Vorjahr auf 148 Millionen Tonnen CO2 leicht an. Nachdem die Corona-Einschränkungen weitgehend aufgehoben worden seien, habe der Pkw-Verkehr wieder leicht zugenommen, so das Bundesumweltamt. Der Zuwachs bei den Neuzulassungen von Elektroautos reiche nicht aus, um die Zunahme der Emissionen auszugleichen.
"Im Verkehrssektor ist die notwendige Trendwende weiterhin nicht zu beobachten", heißt es in einem Gutachten des Expertenrats für Klimafragen, der Bundesregierung und Bundestag für eine Bewertung der Emissionsdaten vorlegt. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, zeigten Szenarien, dass es auch einen Abbau des Bestands fossiler Pkw geben müsste. Dieser Trend, der sich spätestens ab dem Jahr 2025 abzeichnen müsste, sei aber noch nicht zu erkennen.