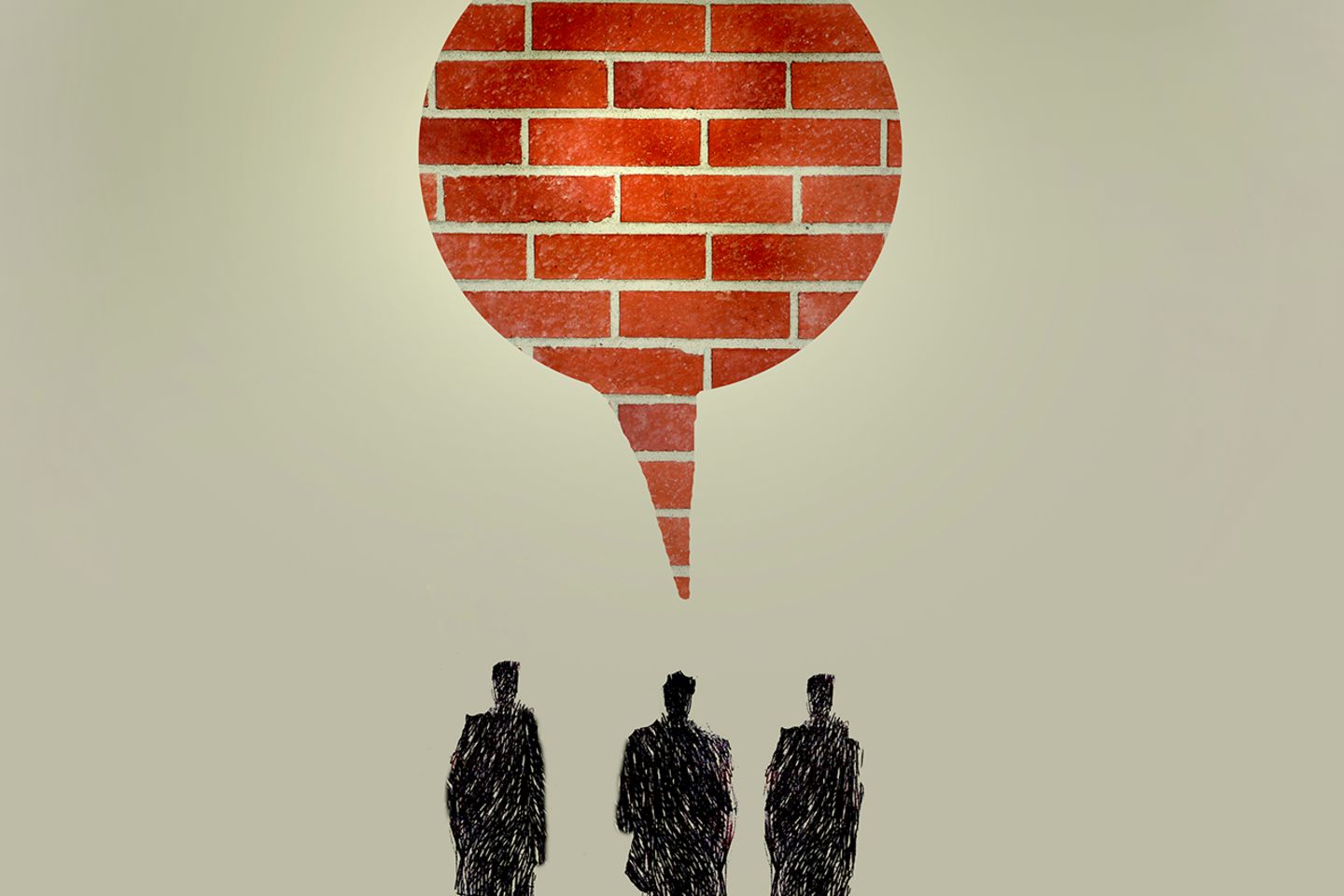Es könnte alles so einfach sein. Jemand sagt auf einer Party: „Für die Klimaerwärmung ist eindeutig die erhöhte Sonnenaktivität verantwortlich!“ – „Wie bitte?“, entgegnen Sie. „Sonnenaktivität und Temperatur der Atmosphäre entwickeln sich doch in entgegengesetzte Richtungen! Außerdem lässt sich zeigen, dass der Treibhauseffekt durch menschengemachtes CO2 die Ursache ist.“ Und Sie liefern später in einer Mail auch gleich noch mehrere seriöse Quellen dazu. Wieder einen Menschen von einem Irrglauben befreit?
Weit gefehlt. Denn wenn Ihr Gegenüber jetzt kleinlaut zugibt, einem wissenschaftlichen Mythos aufgesessen zu sein, erleben Sie die absolute Ausnahme. Im Normalfall sind wissenschaftliche Mythen hartnäckige Gebilde.
Warum das so ist, erläutern der Physiker John Cook und der Psychologe Stephan Lewandowsky von der australischen Universität von Queensland und der Universität von Westaustralien in ihrem Handbuch „Wiederlegen, aber richtig“. Und sie zeigen auf, wie das Richtigstellen besser gelingt.
1. Den Mythos über den Mythos widerlegen
Zunächst, schreiben die beiden Forscher, gelte es, einen Mythos über das Entkräften von Mythen zu zerstören. Man dürfe nämlich nicht annehmen, dass ein Irrtum auf einem Mangel an Wissen beruhe. Der Mensch ist kein Computer. Er hat auch Motive, eine Weltanschauung, und er nimmt Informationen nicht ungefiltert auf. Und er korrigiert sie nicht automatisch, wenn bessere verfügbar sind.
Nicht das Was, sondern das Wie ist oft entscheidend für die individuelle Informationsverarbeitung. Dazu gehört auch, dass einmal aufgenommene Falschinformationen haften bleiben. Schon 1994 hatten Wissenschaftler in einem Versuch Probanden mit falschen Informationen über einen Lagerhausbrand gefüttert. Und mussten feststellen, dass die Fehlinformationen fortwirkten – auch nachdem die Probanden aufgeklärt worden waren.
2. Den Bumerang-Effekt des Vertrauten vermeiden
Wer eine falsche Behauptung wiederholt, um sie zu wiederlegen, riskiert, das Gegenteil zu erreichen. Das klingt zunächst paradox. Doch dass es einen solchen Mechanismus gibt, konnte in psychologischen Experimenten gezeigt werden. Denn die Kennzeichnung als Falschinformation („Viele Leute glauben, dass …“ oder „Es ist ein Mythos, dass …“) wird vom Gehirn als Detail unterschlagen. Was bleibt, ist das Gerücht, der Mythos. (So gesehen, haben wir hier einiges falsch gemacht.) Eine mögliche Gegenmaßnahme ist, den Mythos gar nicht zu erwähnen. Was schwierig sein kann. In jedem Fall sollten Sie sich auf die Fakten konzentrieren. Denn um die geht es ja schließlich.
3. Das Gegenüber nicht mit Informationen überfordern
Traurig, aber wahr: Für unser Gehirn sind einfach zu verstehende Gerüchte viel interessanter als komplizierte Widerlegungsversuche. Versuchen Sie darum nicht, Ihr Gegenüber mit zu vielen Argumenten zu „erschlagen“ – egal, wie gut sie sind. Denn Komplexität wirkt einschüchternd und abschreckend. Punkten Sie lieber mit prägnanten, leicht verständlichen Fakten: „97 von 100 Klimawissenschaftlern sind sich einig, dass die Menschheit die globale Erwärmung verursacht.“
4. Nicht in die Weltanschauungsfalle tappen
Wenn unsere Identität in Frage steht ist, hört der Spaß – und die Diskussion – auf. In Experimenten konnten Wissenschaftler zeigen, dass wir dazu neigen, Argumente und Quellen zu bevorzugen, die unseren eigenen Überzeugungen entsprechen. Wenn die aber durch Argumente in Frage gestellt werden, gehen wir nicht zum Nachdenken – sondern zum Gegenangriff über. Das musste auch der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch erleben, nachdem er das Grundsatzprogramm der AfD auseinandergenommen hatte.
Wir beschäftigen uns in solchen „Verteidigungsfällen“ nicht mehr mit Fakten, sondern vor allem damit, wie sich die gegnerischen Argumente entkräften lassen. Dabei verfestigen sich unsere Ansichten unter Umständen sogar noch. Einsicht und Korrektur: Fehlanzeige. Ein Beispiel aus den USA, wie man es besser machen könnte: Traditionell steuerfeindliche Republikaner reagieren auf klimabezogene Kosten weniger allergisch, wenn man sie statt „Steuer“ „CO2-Abgabe“ nennt.
5. Leerstellen mit richtigen Informationen füllen
Es reicht nicht, Gerüchte zu zerstören, Informationen als nichtig zu entlarven. Denn so etwas hinterlässt eine Lücke beim Gegenüber. Und das verleitet dazu, statt eines unvollständigen Bildes doch lieber das falsche beizubehalten. Das zeigt auch das Experiment mit dem erfundenen Lagerhausbrand. In dem Bericht war von Explosionen die Rede, und in diesem Zusammenhang wurden auch Farb- und Gasbehälter erwähnt. Weiter unten im Bericht wurde allerdings klargestellt, dass es im Lagerhaus keine gab. Später nach der Ursache der starken Rauchentwicklung gefragt, nannten später viele Probanden – die Ölfarben.
Darum ist es wichtig, nicht nur zu verneinen, sondern alternative Erklärungen anzubieten. Ein Beispiel: die sogenannte Oregon-Petition. Diese Unterschriftenaktion wird von Klimaskeptikern gerne angeführt, um zu „beweisen“, dass es in der Klimaforschung keinen Konsens gebe. Angeblich würden 31.000 Wissenschaftler dem Konsens zur menschengemachten Erderwärmung widersprechen. Stimmt! Können Sie dann sagen. Aber von denen waren 99,9 Prozent keine Klimaforscher.