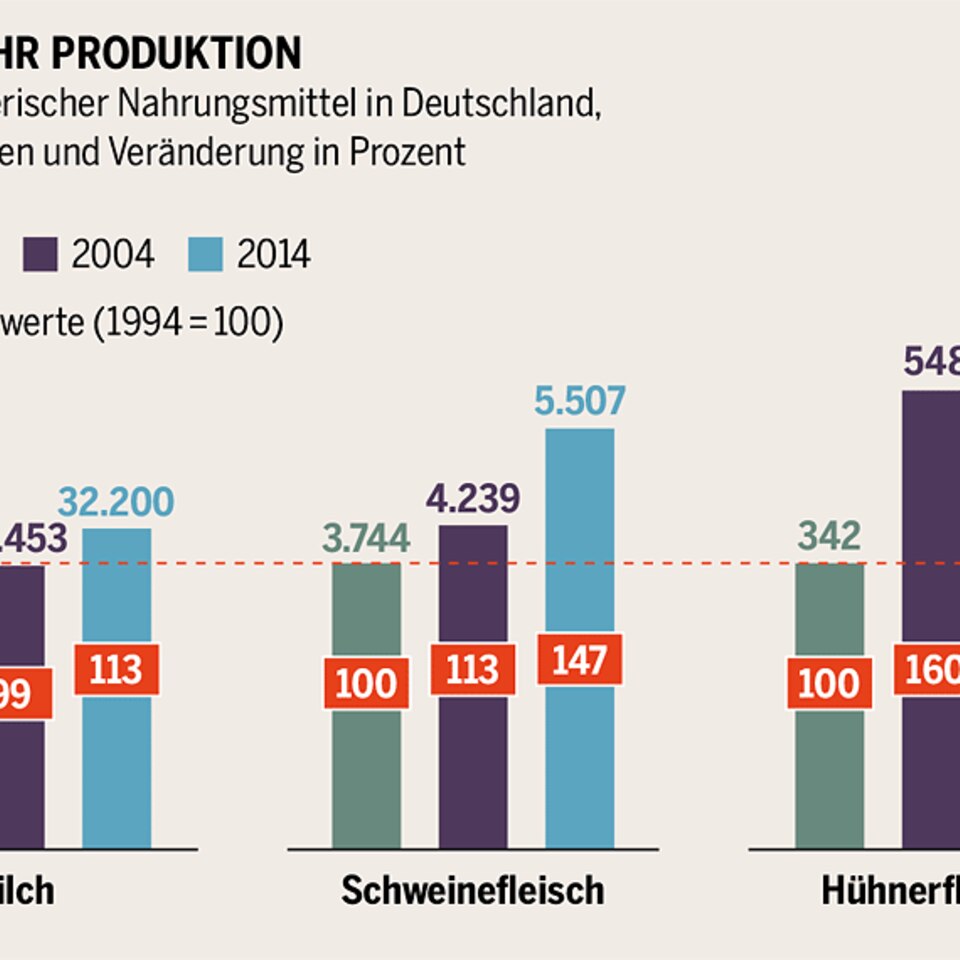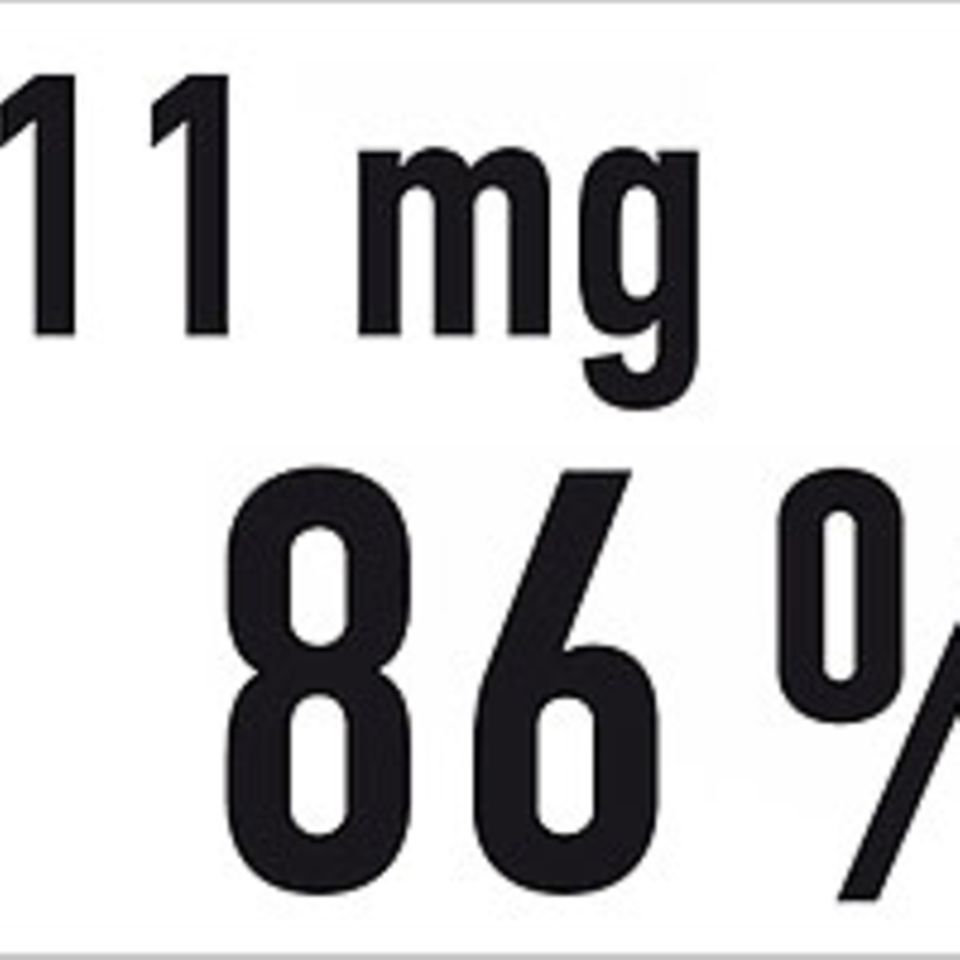Die Fleischproduktion entwickelt sich zu einem ernst zu nehmenden Klimaproblem. Sie ist weltweit für mehr Emissionen verantwortlich als der gesamte Verkehrssektor - mit steigender Tendenz. Denn Steak und Schweinefilet kommen in den wachsenden Mittelschichten der Schwellenländer immer häufiger auf den Tisch.
Während die Chinesen 1982 noch durchschnittlich 13 Kilogramm pro Jahr vertilgten, sind es heute 63 Kilogramm. Und nach Berechnungen von Experten kämen bis 2030 weitere 30 Kilogramm hinzu, sollte es nicht gelingen, den Trend zu stoppen.
Nun macht eine Meldung Klimaschützern Hoffnung: Die chinesische Regierung will mit neuen Ernährungsempfehlungen den Fleischkonsum seiner Bürger praktisch halbieren. Nur noch 40 bis maximal 75 Gramm Fleisch sollen die 1,3 Milliarden Chinesen pro Tag zu sich nehmen. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen - sondern auch dem Klima zuliebe. Nach den neuesten Empfehlungen würde sich der Fleischverzehr wieder den 80-er Jahren annähern: Nur noch 14 bis 27 Kilogramm landeten demnach pro Kopf und Jahr auf dem Teller.
Vorreiterrolle für China?
Zwar ist der Fleischkonsum in den westlichen Industrienationen, etwa in den USA oder in Deutschland, höher als in China. Doch wegen seiner Größe und seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung spielt das Land eine wichtige Rolle. Die Chinesen allein vertilgen 28 Prozent der weltweiten Fleischproduktion - und die Hälfte des gesamten Schweinefleischs.
Da es sich nur um Empfehlungen handelt, wird die Herausforderung nun darin bestehen, die Menschen zum Umdenken zu bewegen. Unterstützung erhält die chinesische Regierung von der amerikanischen Tierschutzorganisation WildAid. Die startete eine Video-Kampagne - mit Arnold Schwarzenegger und Titanic-Regisseur David Cameron als Frontmänner. "Mit seinem Vorstoß, den Fleischkonsum zu halbieren, könnte China eine Führungsrolle dabei übernehmen, die Treibhausgas-Emissionen drastisch zu reduzieren und die Klimaziele von Paris zu erreichen", sagte Cameron.
Wachsender Fleischkonsum ist ein globales Problem
Weltweit gehen 14,5 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen auf das Konto von Rinder-, Schweine- und Hühnerhaltung und -mast. Vor allem Rinder erzeugen bei der Verdauung große Mengen von extrem klimaschädlichem Methan. Und für den Anbau von eiweißreichen Futtermitteln wie Soja werden vor allem in Südamerika Regenwälder und Grünland zerstört. Stickstoffdünger sorgt für zusätzliche Emissionen.
Dass der Ernährungsstil klimarelevant ist, belegen mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen. Eine britische Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine fleischhaltige Ernährung im Vergleich zu einer vegetarischen zu 50 Prozent höheren Emissionen führt. Verglichen mit einer veganen Ernährung sind es sogar doppelt so viele.
Jüngst empfahlen Forscher des World Resources Institute, die Aufnahme von tierischen Nahrungsmitteln – besonders Rinderfleisch - zu reduzieren, um Klima und Böden zu schonen: Eine wichtige Botschaft in Zeiten der wachsenden Weltbevölkerung. Die Welternährungsorganisation FAO hat errechnet, dass sich beim gegenwärtigen Trend bis 2050 eine Lücke von 70 Prozent der erforderlichen Kalorien auftun würde. Produktivitätssteigerungen allein werden nicht ausreichen, um sie zu schließen.
Eine Abkehr vom chinesischen Wachstumspfad nennt Matt Grager von WildAid eine Win-win-Situation: ein Gewinn für die Gesundheit der Menschen und ein Gewinn für den Klimaschutz. Hinzuzufügen wäre: Hunderten Millionen Rindern, Schweinen und Hühnern würde ein elendes Leben erspart. Und der Schlachthof.
WildAid-Studie: Eating for tomorrow - How China's food choices can help mitigate climate change (PDF)