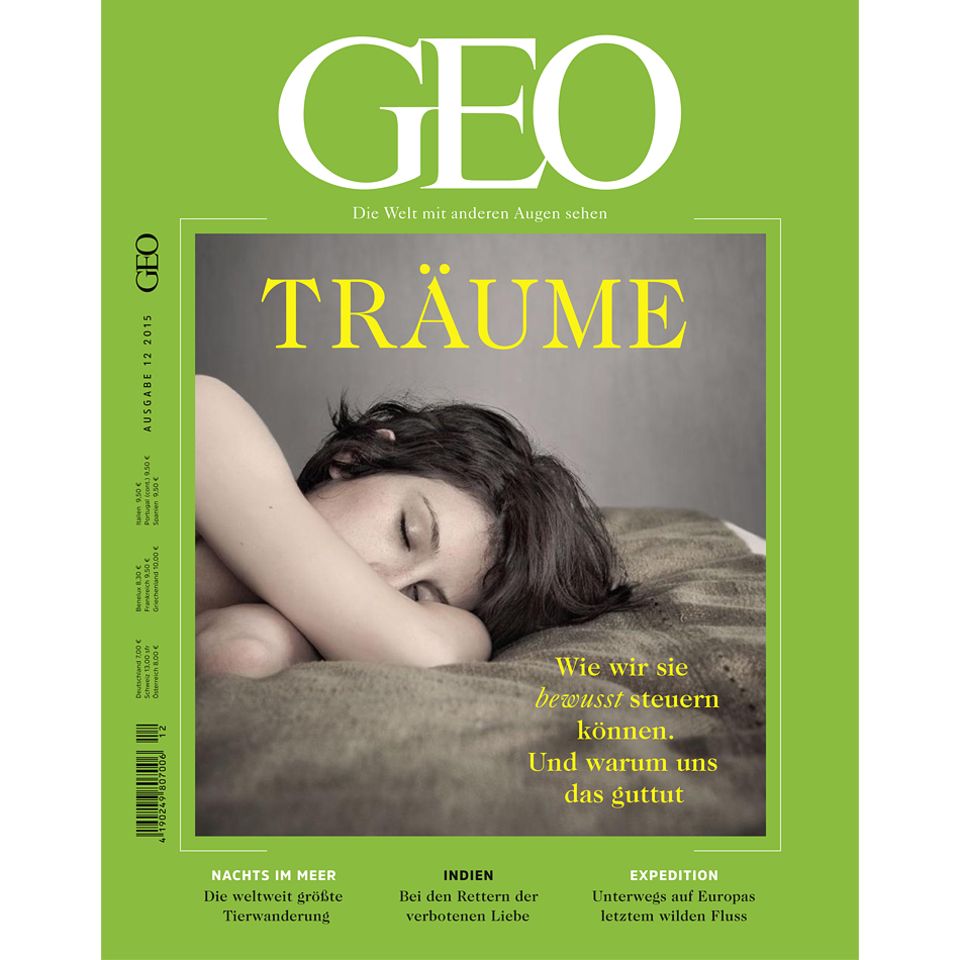Warum vergesse ich meine Träume so schnell?
Diese schlichte Frage hat schon Generationen von Psychologen beschäftigt. Zahlreiche Studien erkunden den Einfluss verschiedener Faktoren auf das Traumgedächtnis – Persönlichkeit, Alter, Geschlecht, Trauminhalt, Schlafdauer –, doch die Befunde ergeben kein eindeutiges Bild. Eine neuere Hypothese stützt sich auf die (bewiesene) Tatsache, dass unser Gehirn nach dem Aufwachen bis zu 15 Minuten braucht, um zu voller Leistungsfähigkeit „hochzufahren“. In dieser Phase arbeitet vermutlich auch das Gedächtnis nur eingeschränkt und vermag Trauminhalte nicht nachhaltig zu speichern.
Kann ich meine Traumerinnerung verbessern?
Ja, das geht leicht. Legen Sie sich Stift und Notizblock auf den Nachttisch und fassen Sie vor dem Einschlafen den Vorsatz, sich am nächsten Morgen an einen Traum zu erinnern. Bleiben Sie nach dem Aufwachen einige Momente reglos liegen und notieren Sie das Erlebte sofort: Nach dem Duschen ist es vermutlich schon gelöscht. Wenn Sie diese Praxis einige Wochen beibehalten, werden Sie schon bald mindestens einen Traum pro Nacht festhalten können. Und die Erinnerungen daran werden zusehends lebhafter werden.
Ich erinnere mich fast nie an Träume. Kann es sein, dass ich in den meisten Nächten gar keine habe?
Nein. Zwar können Medikamente oder Hirnschädigungen die Traumerinnerung beeinträchtigen. Aber grundsätzlich gilt: Wer über Bewusstsein verfügt, der träumt auch. Denn unser Gehirn wird auch im Schlaf nie „abgeschaltet“, wie man früher dachte, sondern ist fast ebenso aktiv – nur die Aktivierungsmuster sind andere als im Wachzustand. Es spricht sogar vieles dafür, dass wir die ganze Nacht träumen. Versuche im Schlaflabor zeigen: Wann immer man Menschen weckt – ob kurz nach dem Einschlafen oder mitten in einer Tiefschlafphase –, berichten sie von Traumerlebnissen. Nur verändern sich diese im Laufe der Nacht: Während des Einschlafens ähneln sie eher Gedanken, sind vergleichsweise realitätsnah. Bilderreiche Träume mit verwickelter Handlung sind dagegen typisch für die REM-Schlafphasen. Solche Erkenntnisse bringen Hirnforscher auf eine neue, spannende Frage. Wenn unser Bewusstsein uns ständig einen „Film“ vorspielt – wieso haben wir überhaupt das Gefühl, während des Schlafs im Dunkel zu versinken?
Können Träume das Leben verändern?
Das kommt vor. Der US-amerikanische Schlafforscher William Dement, zeitweise starker Raucher, sah im Traum ein Röntgenbild seiner Lunge, die von Tumoren durchwuchert war. Nach dem Aufwachen rührte er zeitlebens keine Zigarette mehr an. Viele wissenschaftliche Entdeckungen und Kunstwerke gehen auf nächtliche Eingebungen zurück. Die Struktur des Periodensystems etwa, die Nähmaschine, Bilder von Salvador Dalí sowie der Beatles-Song „Yesterday“. Und nicht nur Genies können Träume als Inspirationsquelle nutzen: Forscher der Universität Heidelberg sammelten in einer Online-Umfrage unter „Durchschnittsträumern“ Hunderte nächtliche Erlebnisse, die Denkanstöße geliefert hatten – für Studium und Beruf, aber auch für die Lösung persönlicher Probleme.
Warum träumen wir überhaupt?
Genau weiß man es nicht. Als sicher gilt, dass unser Gehirn im Schlaf tagsüber gewonnene Informationen abspeichert, neue mit älteren Erinnerungen verknüpft. Ob die Träume selbst dabei eine eigene Funktion haben, ist noch nicht geklärt. Vielleicht sind jene Kinder auf der richtigen Spur, die in einer Umfrage der Züricher Psychologin Inge Strauch auf folgende Erklärung kamen: „Wir träumen nachts, damit uns im Schlaf nicht langweilig wird.“
Können uns Träume die Zukunft zeigen?
Viele Menschen berichten von nächtlichen Erlebnissen, die später in der Realität eintraten: unverhoffte Besuche oder Beförderungen, aber auch tragische Ereignisse wie der Tod nahestehender Menschen. Einer der berühmtesten „präkognitiven Träume“ wird Abraham Lincoln zugeschrieben: Der 16. Präsident der USA soll im April 1865 von seinem Tod geträumt haben, wenige Tage bevor er während einer Theateraufführung erschossen wurde. Man muss freilich keine übernatürlichen Kräfte bemühen, um solche Träume zu erklären. Denn was wir im Schlaf erleben, spiegelt immer unsere aktuellen Ängste und Hoffnungen wider. Unser Traumbewusstsein konstruiert aus diesen Gedankenbausteinen konkrete Fantasien. Dass diese sich gelegentlich bewahrheiten, ist manchmal tragisch. Aber fast immer logisch.