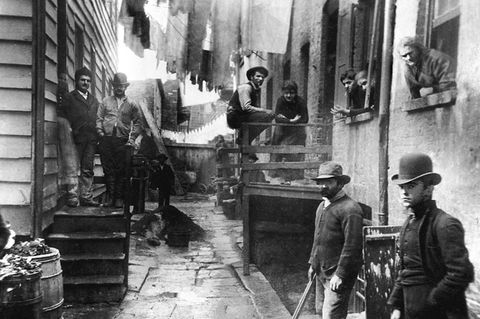Zum Frühstück eine Tasse, auf dem Weg zur Arbeit einen to go. Nach dem Mittagessen. Und dann noch einen gegen das Nachmittags-Tief: Wir trinken Kaffee literweise, buchstäblich. Der deutsche Kaffeeverband schätzt, dass jede/r Deutsche im vergangenen Jahr statistisch 164 Liter konsumiert hat, Säuglinge und Teetrinker eingerechnet. Das ist fast ein halber Liter täglich. Der Trend wird derzeit noch durch einen fallenden Kaffee-Preis angefeuert. Und zugleich wächst die Nachfrage international mit einer erstarkenden Mittelschicht in den Schwellenländern.
Doch Experten warnen: Kaffee könnte zum Luxusgut werden. Denn die Anbauflächen sind begrenzt – und werden mit dem Fortschreiten des Klimawandels weiter schrumpfen.
Ausweichen in geeignete Anbaugebiete ist nicht überall möglich
Das Problem: Die Kaffeepflanze braucht zum Gedeihen ein bestimmtes Klima, ausreichend Wasser und Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad Celsius - vor allem kühle Nächte. Doch die werden, etwa im wichtigsten Exportland Brasilien, bei global steigenden Temperaturen rar. Tagsüber klettert das Thermometer hier immer öfter auf über 30 Grad. Schon 2015 registrierten Forscher des internationalen Agrarforschungsinstituts CGIAR eine Zunahme der Temperaturen in Brasilien und in Afrika, wo überwiegend die Arabica-Sorte angebaut wird. Und die ragiert auf steigende Temperaturen mit einem Wachstums-Stopp und gelben Blättern.
Kaffeebauern weichen darum in höher gelegene Anbaugebiete aus. Doch in vielen Anbauregionen sind die am höchsten gelegenen Gebiete bereits erreicht. Ein Ausweichen ist hier nicht mehr möglich. Besonders hart wird es den Export-Weltmeister treffen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts, prognostiziert der Klimaforscher Romero Ruiz, könnte die Fläche, auf der in Brasilien Kaffee angebaut wird, sogar um 80 Prozent schrumpfen.
"Die Hälfte aller Anbaugebiete der Erde wird in Zukunft keinen Kaffee mehr liefern", resümieren die Journalisten Wilfried Bommert und Marianne Landzettel in ihrem Buch „Verbrannte Mandeln. Wie der Klimawandel unsere Teller erreicht“. Stattdessen, so die Autoren, würde Coffea arabica zukünftig in größerer Entfernung vom Äquator angebaut, etwa in Ostafrika oder Indonesien. Dann allerdings auf Kosten der verbliebenen natürlichen Regenwälder.
Neue Anbaugebiete, neue Rodungen?
Dass steigende Nachfrage und der Verlust von geeigneten Anbaugebieten zu höheren Preisen führen, scheint also sicher. Zumal, nach Angaben des Fairtrade-Siegels, der Weltmarktpreis schon seit Jahren unter den Produktionskosten der Kaffeebauern liegt.
Und dann? Mittelfristig könnte die braune Bohne zum Luxusgut werden. Oder, wie Wilfried Bommert und Marianne Landzettel die aktuellen Entwicklungen zusammenfassen: "Für den Normalverdiener könnte die Kaffeepause ausfallen." Wer bis dahin mit dafür sorgen möchte, dass die Kaffeebauern von ihren Pflanzen auskömmlich leben können, der greift am besten zu fair gehandeltem Kaffee - etwa mit dem Fairtrade- oder dem Gepa-Siegel.