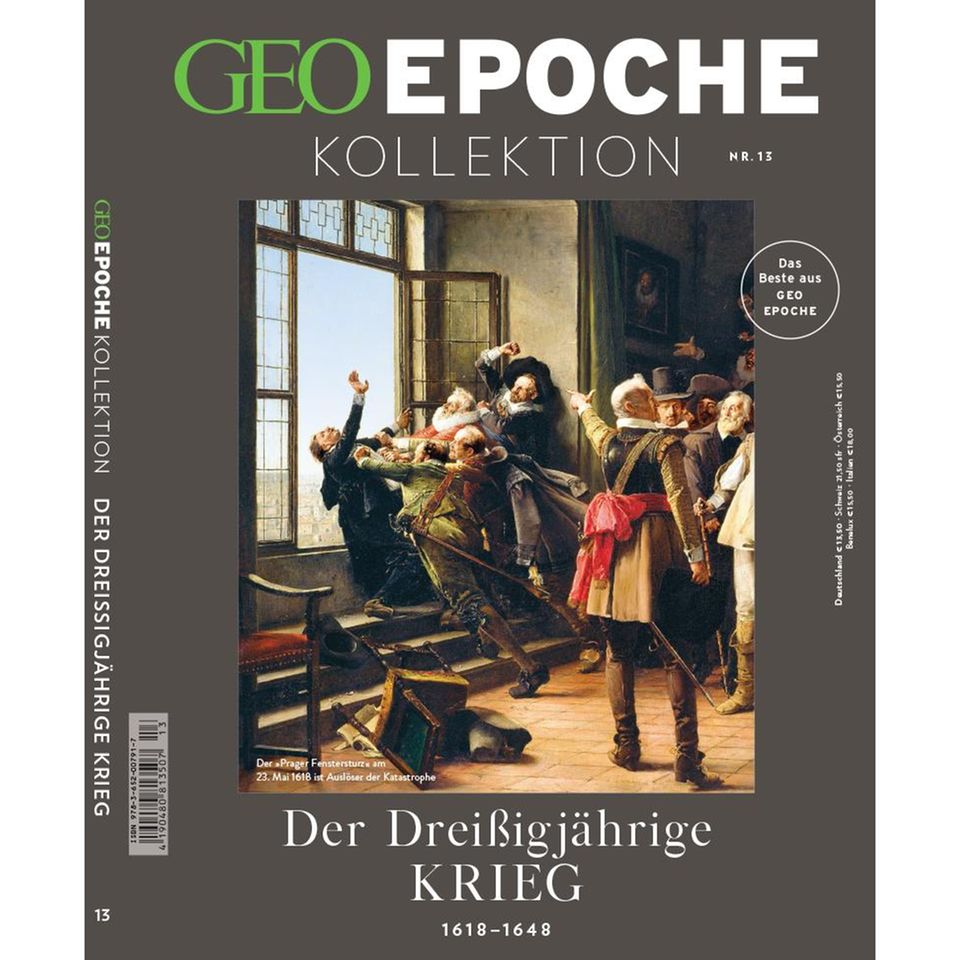Nur eine Wahrheit darf es in der heiligen Stadt Genf geben, nur eine Lehre: seine. Jede Häresie muss bekämpft werden. So will es Johannes Calvin. Der Reformator sieht sich als Werkzeug Gottes und hat in der Schweizer Metropole eine protestantische Tugend-Tyrannei errichtet. Unnachgiebig lässt er alle Abweichungen vom calvinistischen Moralkodex bestrafen – etwa Trunksucht, Prügeleien, das Singen unanständiger Lieder. Und ein Mann wie Michel Servet, der „alle Fundamente des Christentums“ zerstöre, verdient den Tod, da ist sich Calvin sicher.
Die beiden Kontrahenten kennen einander seit mehr als zwei Jahrzehnten: Erstmals sind sie sich wohl um 1532 in Paris begegnet. Der frühere Mönch Servet stand damals wegen einer theologischen Streitschrift auf den Fahndungslisten der Inquisition; an der Seine studierte er unter falschem Namen Medizin, Astrologie und Mathematik. Calvin (in Paris als Student der Philologie und der Rechte) war zu jener Zeit noch Katholik, zweifelte aber wohl bereits an manchen Dogmen seiner Kirche, fühlte sich zu reformatorischen Lehren hingezogen.
Calvin beschrieb Gott als strengen Richter
Nach religiösen Unruhen mussten die beiden 1534 aus Paris fliehen. Calvin wandte sich ganz der Theologie zu und folgte schon bald in großen Teilen den Ideen Martin Luthers. Doch während der deutsche Reformator die Barmherzigkeit Gottes betonte, beschrieb Calvin den Schöpfer als strengen Richter gegenüber allen, die ihm nicht gehorchen.
1541 berief der Rat der schon länger protestantischen Stadt Genf den mittlerweile prominenten Theologen zum Kirchenoberhaupt. Calvin suchte in seiner neuen Position dem Willen Gottes Geltung zu verschaffen, durch strenge Zucht. Selbst Tanzveranstaltungen verbot er, Ehebrechern drohte nun die Todesstrafe.
Michel Servet arbeitete unterdessen als Leibarzt eines französischen Erzbischofs – und korrespondierte insgeheim mit protestantischen Theologen. Doch obwohl er Luthers Thesen vielfach unterstützte, sahen auch die meisten reformatorischen Kirchenmänner in ihm einen Abweichler. Denn Servet lehnte einen zentralen Glaubenssatz ab: das Dreifaltigkeitsdogma, dem nicht nur die Katholiken folgten, sondern auch Luther weiterhin anhing. Jesus sei nicht – wie es die Theologen lehren – der „ewige Sohn Gottes“, der als Teil der Trinität schon an der Schöpfung beteiligt war, sondern, so Servet, „Sohn des ewigen Gottes“: göttlich und menschlich zugleich.
Auch Calvin erhielt von ihm theologische Briefe – und war erbost: „Sollte der Ketzer nach Genf kommen“, schrieb er einem Freund, „so lasse ich ihn nicht wieder lebendig ziehen.“
Seine Briefe bringen Michel Servet den Tod
Anfang 1553 erscheint Servets Schrift „Die Wiederherstellung des Christentums“. Obwohl der Text anonym veröffentlicht wird, erkennt Calvin sofort den Autor, denn die empörenden Aussagen in dem Buch sind ihm aus dessen Briefen wohlbekannt. Wenige Monate später wird Servet von Inquisitoren in Vienne verhaftet – nach einem Hinweis eines Genfer Protestanten.
Ob Calvin selbst den Verrat veranlasst hat, ist ungewiss, immerhin aber liefert er den Inquisitoren Beweismaterial: Servets Briefe. Doch bevor der Angeklagte verurteilt wird, gelingt ihm die Flucht – und ausgerechnet in Genf macht er Station. Glaubt Servet, er würde dort unentdeckt bleiben, oder erwartet er, Calvin würde angesichts selbst erlebter Verfolgung Milde walten lassen? Niemand weiß es bis heute.
Für Calvin ist Milde keine Option: In seinen Augen bringen Servets Lehren die Kirche in Unordnung. Würde er ihm Asyl gewähren oder ihn ziehen lassen, gäbe er die ganze Stadt der Strafe Gottes preis. Deshalb erwirkt er beim Magistrat die Verhaftung des Flüchtlings.
Gut zwei Monate später verurteilt das Gericht den Beschuldigten wegen Leugnung des dreifaltigen Gottes und anderer Irrlehren zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Am 27. Oktober 1553 wird das Urteil vollstreckt. „O Jesus, Sohn des ewigen Gottes, erbarme dich unser“ sind die letzten Worte Servets – des ersten Christen, den Protestanten als Ketzer in den Feuertod schicken.