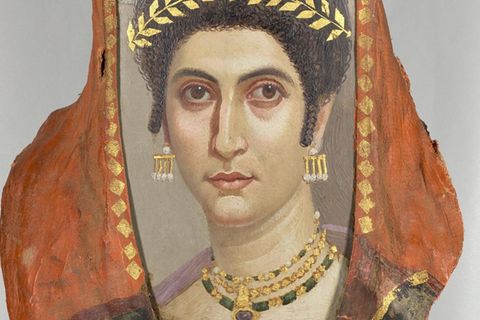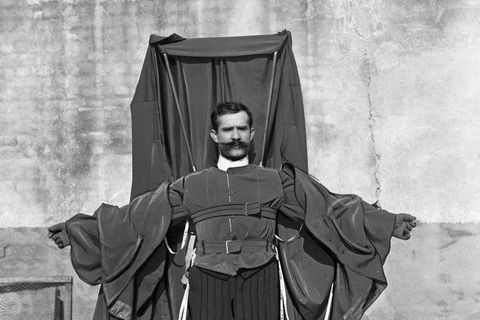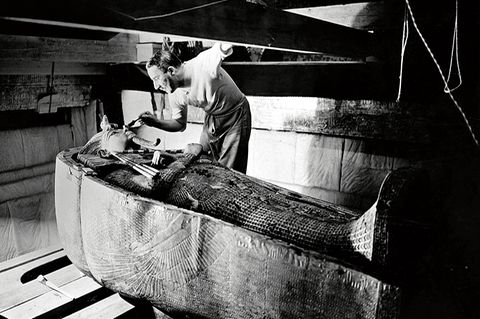Es ist Freitagabend, 18 Uhr. London hängt, wie so oft, unter einer dichten Nebelglocke. "Erbsensuppe" nennen die Einwohnerinnen und Einwohner jenen Dunst aus Industrieschloten und Kohleöfen, der die Metropole regelmäßig einhüllt. Doch diese Wolke, die sich am 5. Dezember 1952 zusammenbraut, ist anders. Denn sie bringt den Tod.
Fünf Tage lang wird der Nebel London heimsuchen. Er wird das öffentliche Leben lahmlegen, Menschen in absolute Orientierungslosigkeit stürzen und Schätzungen zufolge 12.000 Opfer fordern. Und er wird als "Great Smog", als eine der tödlichsten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen Europas, in die Geschichte eingehen.
Im "Great Smog" schrumpfte die Sichtweite auf 30 Zentimeter
Es sind mehrere unheilvolle Entwicklungen, die 1952 zur Katastrophe führten: London mit seinen damals 8,3 Millionen Einwohnern war seit der Industrialisierung ein gigantischer stinkender Moloch. Fabriken, Eisenbahnen, Kohleöfen, Kraftwerke und dieselbetriebene Busse und Straßenbahnen verpesten die Luft. Smog war in London nichts Neues. Aber in jenen verhängnisvollen Dezembertagen verhinderte eine außergewöhnliche Wetterlage, dass der Dunst aus London abziehen konnte: Ein Hochdruckgebiet über Südengland und anhaltende Windstille bewirkten, dass warme Luftmassen über London die kältere, verschmutzte Luft in der Stadt wie einen Deckel am Boden hielten.
Davon ahnen die Londonerinnen und Londoner, die die Giftwolke für normalen Nebel halten, nichts. Für sie ist der Dunst zunächst vor allem ein Verkehrshindernis. Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge stehen lassen, weil sie nichts mehr sehen, Busse und Züge bleiben liegen, der Flughafen wird geschlossen. Die Sichtweite schrumpft auf 30 Zentimeter.
London, eingehüllt in giftigen Dunst

London, eingehüllt in giftigen Dunst
"Es war, als wenn man erblindet wäre", beschreibt der Zeitzeuge Tom Cribb. Man konnte seine Füße nicht mehr auf der Straße sehen, so neblig sei es gewesen. Ungezählte Menschen verirrten sich auf Londons Straßen, weil sie nicht mehr erkennen konnten, wo sie sich befanden. "Ich musste mich an einer Hauswand entlangtasten, bis ich ein Schild mit dem Namen der Straße fand, um herauszufinden, wo ich war", erinnert sich Donald Acheson, ein anderer Londoner.
Schulunterricht fällt aus, weil Eltern befürchten müssen, dass ihre Kinder auf dem Weg verloren gehen. Wer sich einmal in den Nebel gewagt hat, ist von einer Rußschicht überdeckt. "Es war, als wäre ich in eine Schlammpfütze gefallen, als ich nach Hause kam", schildert ein Zeitzeuge. Gesicht, Augenbrauen, Haare, Fingernägel: Alles sei verdreckt gewesen.
Der Nebel kriecht auch in die Gebäude. Laufende Theatervorstellungen müssen abgebrochen werden, weil Zuschauerinnen und Zuschauer nichts mehr erkennen können. Kinos schließen, Fußballspiele fallen aus.
Nur die Krankenhäuser füllen sich. Da die Krankenwagen wegen des Nebels nicht fahren, versuchen ungezählte Menschen, sich keuchend und um Luft ringend den Weg durch die Dunstwolke zu den Kliniken zu bahnen. Die stoßen schnell an ihre Grenzen: "Es waren einfach zu viele betroffen. Viele schafften es nicht mehr ins Krankenhaus hinein und starben draußen", erinnert sich Robert Waller, damals Arzt im St. Bartholomew's Hospital. Im Middlesex Hospital wissen die Mitarbeitenden bald nicht mehr, wohin mit den Toten. Als die Leichenhalle voll ist, bringen sie die Verstorbenen in den Sezierraum der Anatomie.
Am 9. Dezember endlich vertreibt Wind den Smog – erst jetzt wird das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Insgesamt müssen 150.000 Menschen in Krankenhäusern behandelt werden, vor allem wegen Herz-Kreislauf- oder Atemwegsbeschwerden. Behörden zählen 4000 Tote, rund 8000 weitere sterben in den nächsten Wochen und Monaten an den Folgen des "Great Smog".
Die Lehren aus dem "Great Smog"
Warum der Nebel in jenen Tagen so gefährlich war, werden Forschende erst Jahrzehnte später aufklären: Neben Schwefeldioxid enthielten die Abgase Stickstoffdioxid. Diese Substanz sorgte im Zusammenspiel mit feinen Wassertröpfchen in der Luft dafür, dass sich aus Schwefeldioxid giftige Schwefelsäure bilden kann. Und da es in jenen Dezembertagen 1952 besonders feucht war, konnte in der Luft viel Säure entstehen – die Menschen schließlich einatmeten.
1953 stritt die britische Regierung noch jede Verbindung zwischen dem Smog und den Todesfällen ab – und machte das außergewöhnliche Wetter für die Katastrophe verantwortlich, wohl auch auf Rücksicht auf die Industrie. Erst als der öffentliche Druck immer größer wurde, verabschiedete sie 1956 den Clean Act. Seitdem ist die Verwendung pechhaltiger Kohle zum Heizen in Privathaushalten verboten, gleichzeitig sollten Industrieanlagen sauberer werden. Weitere Verschärfungen in den 60ern führten dazu, dass die Luftqualität tatsächlich besser wurde: Langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Luft vor menschenverursachter Verschmutzung besser geschützt werden muss.